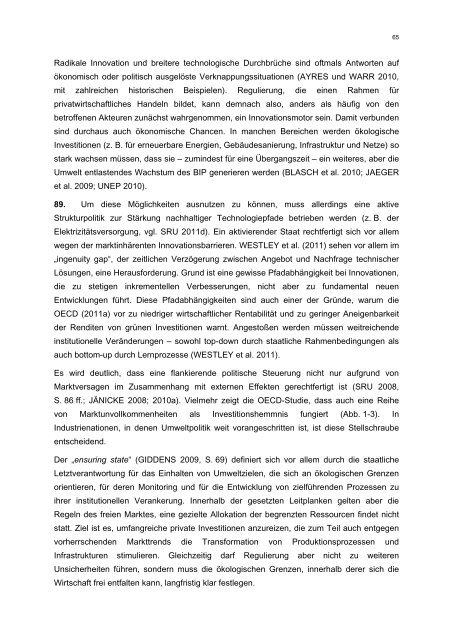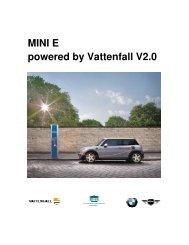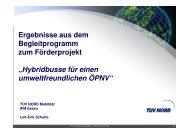- Seite 1 und 2:
ãïÉäíÖìí~ÅÜíÉå= OMNO=
- Seite 3 und 4:
II Danksagung Der SRU dankt den Ver
- Seite 5 und 6:
IV - Beirat für Nachhaltige Entwic
- Seite 7 und 8:
VI 1.5.2 Wachstumszwänge in der po
- Seite 9 und 10:
VIII 4.2.1 Historische Entwicklung
- Seite 11 und 12:
X 6.2.6.2 Konflikt: Waldumbau und K
- Seite 13 und 14:
XII 8.7 Literatur .................
- Seite 15 und 16:
XIV 11 Ökologische Grenzen einhalt
- Seite 17 und 18:
XVI Abbildung 5-4 Entwicklung der V
- Seite 19 und 20:
XVIII Tabellenverzeichnis Tabelle 1
- Seite 22 und 23:
Kurzfassung *1. Die umweltpolitisch
- Seite 24 und 25:
gesteigerten Kreislaufführung von
- Seite 26 und 27:
auf erneuerbare Energieträger umzu
- Seite 28 und 29:
Ökologische Mindeststandards sollt
- Seite 30 und 31:
Umweltstandards in der Seeschifffah
- Seite 32 und 33:
materiell zu ermöglichen. Monitori
- Seite 34 und 35:
0 Einführung 0.1 Umweltschutz und
- Seite 36 und 37: der Berufungsperiode bereits in Son
- Seite 38 und 39: Leitbegriffe, wie die Erhaltung der
- Seite 40 und 41: mit den Rahmenbedingungen für indi
- Seite 42 und 43: Vorausverfügung über die Zukunft
- Seite 44 und 45: iologische Vielfalt umfasst Perspek
- Seite 46 und 47: Lebensraum für kommerziell genutzt
- Seite 48 und 49: Lebensstil und veränderte Konsumge
- Seite 50 und 51: Eine Wirtschaft ohne oder mit sehr
- Seite 52 und 53: Impuls-, Vermittlungs- und Innovati
- Seite 54: 39. Das Konzept der ökologischen G
- Seite 57 und 58: 36 1.2 Nachhaltiges Wirtschaften in
- Seite 59 und 60: 38 Abbildung 1-1 Nachhaltigkeitsmod
- Seite 61 und 62: 40 et al. 2011). Die Definition des
- Seite 63 und 64: 42 globale Prozesse haben oder aggr
- Seite 65 und 66: 44 - Bereits heute eignet sich die
- Seite 67 und 68: 46 Konzentration wird die sichere B
- Seite 69 und 70: 48 und gleichzeitig die Belastung d
- Seite 71 und 72: 50 Entkopplung des Energie- bzw. Ma
- Seite 73 und 74: 52 Jahre gestanden allerdings zwei
- Seite 75 und 76: 54 Mehrere aktuelle Studien kommen
- Seite 77 und 78: 56 - Wie kann, wenn wirtschaftliche
- Seite 79 und 80: 58 die Zähmung durch Zivilgesellsc
- Seite 81 und 82: 60 1.6 Herausforderungen für Polit
- Seite 83 und 84: 62 Der Wissenschaftliche Beirat der
- Seite 85: 64 87. Der SRU (2011d) hat exemplar
- Seite 89 und 90: 68 92. Über alternative Methoden u
- Seite 91 und 92: 70 weitverbreiteten Auffassung stä
- Seite 93 und 94: 72 Klimaschutz die Investitionsquot
- Seite 95 und 96: 74 1.6.4 Herausforderungen für die
- Seite 97 und 98: 76 und 4). Eine solche Innovationss
- Seite 99 und 100: 78 1.8 Literatur Aghion, P., Howitt
- Seite 101 und 102: 80 Chontanawat, J., Hunt, L. C., Pi
- Seite 103 und 104: 82 Ausschuss der Regionen. Ressourc
- Seite 105 und 106: 84 IPCC (Intergovernmental Panel on
- Seite 107 und 108: 86 Meyer, B., Meyer, M., Distelkamp
- Seite 109 und 110: 88 Romer, D. (2012): Advanced macro
- Seite 111 und 112: 90 sachverstaendigenrat-wirtschaft.
- Seite 114: Wohlfahrt und Ressourcennutzung ent
- Seite 117 und 118: 96 Handlungsansätzen für einen ef
- Seite 119 und 120: 98 der Gewinnung und Verarbeitung r
- Seite 121 und 122: 100 2.2.1 Auswirkungen auf die biol
- Seite 123 und 124: 102 über Jahrzehnte die Gewässer
- Seite 125 und 126: 104 erneuerbar, da die Grundwassern
- Seite 127 und 128: 106 einen hohen Flächenverbrauch u
- Seite 129 und 130: 108 noch auf das BIP zurückgegriff
- Seite 131 und 132: 110 wird, und dass Bauteile einzeln
- Seite 133 und 134: 112 Stoffströme wie Metallschrotte
- Seite 135 und 136: 114 den deutschen Rohstoffverbrauch
- Seite 137 und 138:
116 Rückführung in den Produktion
- Seite 139 und 140:
118 berechnet werden. Der Unterschi
- Seite 141 und 142:
120 Rohstoffe trennscharf eine Subs
- Seite 143 und 144:
122 Tabelle 2-2 Handlungsansätze,
- Seite 145 und 146:
124 2.4.1 Bergrecht, Naturschutz- u
- Seite 147 und 148:
126 funktionierenden Kooperation zw
- Seite 149 und 150:
128 Da der Importanteil bei Baustof
- Seite 151 und 152:
130 2.4.3 Instrumente für die Krei
- Seite 153 und 154:
132 nicht mehr gebrauchs- oder repa
- Seite 155 und 156:
134 Verwertung erreicht (UBA 2011).
- Seite 157 und 158:
136 - Das Global Mercury Project wu
- Seite 159 und 160:
138 Schutzgebieten auf dem Land auf
- Seite 161 und 162:
140 Rohstoffe und der Verschiebung
- Seite 163 und 164:
142 derzeit noch Kenntnisse fehlen.
- Seite 165 und 166:
144 anzuheben. Wesentlich ist jedoc
- Seite 167 und 168:
146 BGR (2011c): Technische Zusamme
- Seite 169 und 170:
148 Erdmann, L., Behrendt, S., Feil
- Seite 171 und 172:
150 Grant, T., Bonomo, J., Block, M
- Seite 173 und 174:
152 Newell, R. G., Stavins, R. N. (
- Seite 175 und 176:
154 Global Atmosphere: Emissions, M
- Seite 177 und 178:
156
- Seite 179 und 180:
158 Produkte ein relevantes umwelt-
- Seite 181 und 182:
160 Tabelle 3-1 Übersicht über ö
- Seite 183 und 184:
162 Nachwachsende Rohstoffe für di
- Seite 185 und 186:
164 Naturschutzgebiete reichen aufg
- Seite 187 und 188:
166 Treibhausgasen Deutschlands zug
- Seite 189 und 190:
168 liegen. Besonders hohe Emission
- Seite 191 und 192:
170 Tierhaltung verantwortlich ist.
- Seite 193 und 194:
172 Betrieben, die Mastkälber und
- Seite 195 und 196:
174 3.2.7 Zur Bedeutung des ökolog
- Seite 197 und 198:
176 Tabelle 3-4 Gründe für Lebens
- Seite 199 und 200:
178 Tabelle 3-5 THG-Emissionen aus
- Seite 201 und 202:
180 Grundlage der umweltfreundliche
- Seite 203 und 204:
182 dauerhafter Einfluss auf die Le
- Seite 205 und 206:
184 solche Produkte, bei denen der
- Seite 207 und 208:
186 anzunähern. Grundsätzlich gib
- Seite 209 und 210:
188 somit, auch wenn sie grundsätz
- Seite 211 und 212:
190 212. Somit schätzt der SRU das
- Seite 213 und 214:
192 Schüsselgrößen dafür sorgen
- Seite 215 und 216:
194 CO2-Fußabdruck einzelner Produ
- Seite 217 und 218:
196 wurde 2005 auf das gesamte Bund
- Seite 219 und 220:
198 Um die Eigenverantwortung gesel
- Seite 221 und 222:
200 - eine Reduktion des Konsums ti
- Seite 223 und 224:
202 Vertragsnaturschutz erwirtschaf
- Seite 225 und 226:
204 Blengini, G. A., Busto, M. (200
- Seite 227 und 228:
206 EEAC (European Environment and
- Seite 229 und 230:
208 Heindl, I. (2003): Studienbuch
- Seite 231 und 232:
210 LANUV NRW (Landesamt für Natur
- Seite 233 und 234:
212 Raithel, J. (2004): Lebensstil
- Seite 235 und 236:
214 Weidemilch - Chancen und Mögli
- Seite 237 und 238:
216 Entwicklungen zeigt deutlich, d
- Seite 239 und 240:
218 Die Wahl des Verkehrsmittels h
- Seite 241 und 242:
220 Güterverkehrsleistung (Wachstu
- Seite 243 und 244:
222 Tabelle 4-1 Szenarien zur zukü
- Seite 245 und 246:
224 Wachstum im Kontext langfristig
- Seite 247 und 248:
226 In Abbildung 4-4 werden die Emi
- Seite 249 und 250:
228 Diese Faktoren sind aber einem
- Seite 251 und 252:
230 Verkehrswegeinvestitionen - abg
- Seite 253 und 254:
232 Umwegverkehr, insbesondere bei
- Seite 255 und 256:
234 4.3.4 Verkehrsverlagerung auf d
- Seite 257 und 258:
236 aufgezehrt wird, weil im Gegenz
- Seite 259 und 260:
238 4.3.5.1 Elektrifizierung des St
- Seite 261 und 262:
240 gewährleistet, sondern im Hinb
- Seite 263 und 264:
242 259. Eine intensive Produktion
- Seite 265 und 266:
244 einzuleiten. Kurz- bis mittelfr
- Seite 267 und 268:
246 Ausstoß gesundheits- und umwel
- Seite 269 und 270:
248 Anreizwirkung Emissionen einzus
- Seite 271 und 272:
250 Als kritisch erweist sich über
- Seite 273 und 274:
252 öffentlich zugänglichen Simul
- Seite 275 und 276:
254 dabei Einnahmen aus der Lkw-Mau
- Seite 277 und 278:
256 und -szenarien eine Öffentlich
- Seite 279 und 280:
258 MANGOLDT/KLEIN/STARCK 2010, Art
- Seite 281 und 282:
260 des Wissens hinsichtlich zukün
- Seite 283 und 284:
262 Wirtschaftspolitik können eine
- Seite 285 und 286:
264 Um die technologischen Grundlag
- Seite 287 und 288:
266 4.6 Literatur Agnolucci, P., Bo
- Seite 289 und 290:
268 Epiney, A., Heuck, J. (2009): Z
- Seite 291 und 292:
270 Jackson, M. D. (2011): Technolo
- Seite 293 und 294:
272 Pro Mobilität - Initiative fü
- Seite 295 und 296:
274 Unruh, G. C. (2000): Understand
- Seite 297 und 298:
276 oder von Informationen ein Bed
- Seite 299 und 300:
278 292. Hinzu kommt, dass durch de
- Seite 301 und 302:
280 zum Halbjahr 2010 auf (Pressemi
- Seite 303 und 304:
282 Tabelle 5-1 Belastung der Bevö
- Seite 305 und 306:
284 Wirkung auf allergische Erkrank
- Seite 307 und 308:
286 Abbildung 5-4 1200 1100 1000 90
- Seite 309 und 310:
288 Pkws zur Verfügung haben, selt
- Seite 311 und 312:
290 5.3.2 Güter- und Personenwirts
- Seite 313 und 314:
292 5.4 Leitbild und Indikatoren f
- Seite 315 und 316:
294 Infrastruktur- Anforderungen Ra
- Seite 317 und 318:
296 Abbildung 5-6 Quelle: Deutscher
- Seite 319 und 320:
298 („Pendlerpauschale“, BVerfG
- Seite 321 und 322:
300 gesamten Flotte. Der Koalitions
- Seite 323 und 324:
302 Verkehrsplanung berücksichtigt
- Seite 325 und 326:
304 Aufgrund der Komplexität des A
- Seite 327 und 328:
306 Abbildung 5-8 Quelle: UBA 2011b
- Seite 329 und 330:
308 für verschiedene Wege verschie
- Seite 331 und 332:
310 Führerscheininhaber („CarSha
- Seite 333 und 334:
312 335. Umweltzonen bewirken in de
- Seite 335 und 336:
314 Dieselhybridbusse und -Lkws sow
- Seite 337 und 338:
316 ist in Zürich auch ein Schritt
- Seite 339 und 340:
318 (WOLFRAM et al. 2009; ALBRECHT
- Seite 341 und 342:
320 Verkehrsteilnehmer. Dies bedeut
- Seite 343 und 344:
322 5.7 Literatur ADAC (Allgemeiner
- Seite 345 und 346:
324 Bundesregierung (2007): Zweiter
- Seite 347 und 348:
326 IFEU (Institut für Energie und
- Seite 349 und 350:
328 Verkehr. Forschungsergebnisse u
- Seite 351 und 352:
330 Theloke, J., Calaminus, B., Dü
- Seite 354:
Ökosystemleistungen aufwerten
- Seite 357 und 358:
336 Abbildung 6-1 Biologische Vielf
- Seite 359 und 360:
338 6.2.1 Biodiversität und ökosy
- Seite 361 und 362:
340 - Erhaltung und Entwicklung der
- Seite 363 und 364:
342 vielfältigen Leistungen könne
- Seite 365 und 366:
344 Streu und im Boden. Unter besti
- Seite 367 und 368:
346 Berechnungen des Kohlenstoff-Fu
- Seite 369 und 370:
348 Tabelle 6-1 Veränderungen von
- Seite 371 und 372:
350 Holzeinschlag auf 100 Mio. m 3
- Seite 373 und 374:
352 Bioziden, eine Vollbaumnutzung
- Seite 375 und 376:
354 Kronenverlichtungen ist stark a
- Seite 377 und 378:
356 Kriterium für die Ermittlung e
- Seite 379 und 380:
358 Tabelle 6-2 Anteil der Waldflä
- Seite 381 und 382:
360 durchschnittlichen jährlichen
- Seite 383 und 384:
362 internationale Verantwortung vo
- Seite 385 und 386:
364 gesetz sowie den dazugehörigen
- Seite 387 und 388:
366 (WINKEL 2007, S. 276). Die konk
- Seite 389 und 390:
368 - Waldklimafonds besser nutzen:
- Seite 391 und 392:
370 Naturschutzaspekten und der Res
- Seite 393 und 394:
372 10 km 2 aufweisen (BfN 2010b).
- Seite 395 und 396:
374 - BMELV: Waldforum der Vereinte
- Seite 397 und 398:
376 Vorkommen vieler gefährdeter W
- Seite 399 und 400:
378 Bofinger, S., Callies, D., Sche
- Seite 401 und 402:
380 Europäische Kommission (2010):
- Seite 403 und 404:
382 Luyssaert, S., Schulze, E. D.,
- Seite 405 und 406:
384 RNE (Rat für Nachhaltige Entwi
- Seite 407 und 408:
386 Nutzungskonkurrenzen beim weite
- Seite 409 und 410:
388
- Seite 411 und 412:
390 landwirtschaftliche Fläche fü
- Seite 413 und 414:
392 Moorwasser). Flora und Fauna si
- Seite 415 und 416:
394 7.3.2 Treibhausgasemissionen 40
- Seite 417 und 418:
396 Abbildung 7-4 Treibhausgasemiss
- Seite 419 und 420:
398 Quelle: DRÖSLER et al. 2011b,
- Seite 421 und 422:
400 Im Laufe der Nutzung verschlech
- Seite 423 und 424:
402 überstauten, abgetorften Hochm
- Seite 425 und 426:
404 Tabelle 7-2 Paludikulturen auf
- Seite 427 und 428:
406 gegenüber 1990 als Ziel des Ag
- Seite 429 und 430:
408 Das Bayerische Landesamt für U
- Seite 431 und 432:
410 (2007) durchschnittliche THG-Ve
- Seite 433 und 434:
412 Naturschutzprojekte positive Ef
- Seite 435 und 436:
414 Durch die Degradierung und den
- Seite 437 und 438:
416 Pflegemaßnahmen von einigen L
- Seite 439 und 440:
418 Stiftung NaturSchutzFonds verö
- Seite 441 und 442:
420 7.7 Empfehlungen 434. Die folge
- Seite 443 und 444:
422 Phase I 437. 1. Grundlage aller
- Seite 445 und 446:
424 Emissionshandelsrichtlinie aufz
- Seite 447 und 448:
426 vorgelegt werden. Für die sehr
- Seite 449 und 450:
428 BMU (2007): Nationale Strategie
- Seite 451 und 452:
430 Gaudig, G. (2010): Torfmooskult
- Seite 453 und 454:
432 Niedersächsisches Ministerium
- Seite 455 und 456:
434 Strack, M. (Hrsg.) (2008): Peat
- Seite 457 und 458:
436 8.1.1 Nutzung und Belastung der
- Seite 459 und 460:
438 steht bei der Ostsee der Eintra
- Seite 461 und 462:
440 Schiffe (MARPOL). Weitere IMO-A
- Seite 463 und 464:
442 (SRU 2004). Generell fehlt den
- Seite 465 und 466:
444 Beispielsweise sollen Wachstum
- Seite 467 und 468:
446 Deutsche Umsetzung 462. Der Akt
- Seite 469 und 470:
448 weiter auszudifferenzieren und
- Seite 471 und 472:
450 Schwächen der Richtlinie 469.
- Seite 473 und 474:
452 8.3.2 Umsetzung der Richtlinie
- Seite 475 und 476:
454 8.3.2.2 Stand der Umsetzung 478
- Seite 477 und 478:
456 Ein weiterer Bewertungsschritt
- Seite 479 und 480:
458 Die einzelnen Ziele haben immer
- Seite 481 und 482:
460 ambitionierte Ziele mit dem gut
- Seite 483 und 484:
462 anstehenden Reformen in der GAP
- Seite 485 und 486:
464 (IRMER et al. 2010a; WFD Naviga
- Seite 487 und 488:
466 geschützter Meeresgebiete beit
- Seite 489 und 490:
468 In seiner Stellungnahme zum Vor
- Seite 491 und 492:
470 jenseits der Küstenlinie. In d
- Seite 493 und 494:
472 Vorbehaltsgebieten wird bestimm
- Seite 495 und 496:
474 Zwar könnte man annehmen, dass
- Seite 497 und 498:
476 Strategie für ein integriertes
- Seite 499 und 500:
478 - Um dringende Probleme im Meer
- Seite 501 und 502:
480 8.7 Literatur Ahlke, B., Wagner
- Seite 503 und 504:
482 Erbguth, W. (2011): Raumordnung
- Seite 505 und 506:
484 Irmer, U., Werner, S., Claussen
- Seite 507 und 508:
486 Steele, J. H., Thorpe, S. A., T
- Seite 510 und 511:
9 Integrierter Umweltschutz am Beis
- Seite 512 und 513:
diese Frage aber bestehen, denn das
- Seite 514 und 515:
Umweltauswirkungen getroffen werden
- Seite 516 und 517:
Abbildung 9-1 Elemente des integrie
- Seite 518 und 519:
9.3.3 Industrieemissionsrichtlinie
- Seite 520 und 521:
IED). Diese bestimmen die für die
- Seite 522 und 523:
- PRTR). Letzteres beruht auf dem P
- Seite 524 und 525:
539. Die IED verlangt grundsätzlic
- Seite 526 und 527:
9.4.2.1 Emissionsseitige Anforderun
- Seite 528 und 529:
Regel integrativ ist, weil die Able
- Seite 530 und 531:
trat erst im Jahr 2002 die derzeit
- Seite 532 und 533:
Die Wirkungen mancher Zwischen-, En
- Seite 534 und 535:
Qualität der emittierten Stoffe un
- Seite 536 und 537:
harmonisierten Genehmigungsgrundlag
- Seite 538 und 539:
Eine Flexibilisierung der Grenzwert
- Seite 540 und 541:
Anlagenbezogene Gefahrenabwehrpflic
- Seite 542 und 543:
dass sensible Umweltmedien wie das
- Seite 544 und 545:
9.6 Zusammenfassendes Ergebnis und
- Seite 546 und 547:
9.7 Literatur Appel, I. (1995): Emi
- Seite 548 und 549:
Erbguth, W., Stollmann, F. (2000):
- Seite 550 und 551:
Ladeur, K.-H. (1998): Integrierter
- Seite 552 und 553:
Verwaltungswissenschaften Speyer vo
- Seite 554 und 555:
10 Medienübergreifendes Monitoring
- Seite 556 und 557:
und Stoffflüssen sowie aus der Unt
- Seite 558 und 559:
Kontext des Vorsorgeprinzips kann e
- Seite 560 und 561:
Im Bereich des Naturschutzes existi
- Seite 562 und 563:
Umweltvorschriften derzeit vorgeseh
- Seite 564 und 565:
- Beeinträchtigungen naturschutzfa
- Seite 566 und 567:
standardisierten Methoden ermittelt
- Seite 568 und 569:
10.3.3 Monitoring in der Agro-Gente
- Seite 570 und 571:
Stichprobenflächen auf der ganzen
- Seite 572 und 573:
Bei einigen potenziellen PBT-Stoffe
- Seite 574 und 575:
solcher Maßnahmen stellt das Monit
- Seite 576 und 577:
Endokrin wirksame Stoffe 612. Schon
- Seite 578 und 579:
Wirkungen auf Nichtzielorganismen e
- Seite 580 und 581:
erfassen (z. B. Nebenniere, Bauchsp
- Seite 582 und 583:
Tabelle 10-1 Wesentliche Regulierun
- Seite 584 und 585:
Eigenschaften ist nur für die hohe
- Seite 586 und 587:
PNEC-Werte durch die chemische Indu
- Seite 588 und 589:
(Belastungsmonitoring) und im Effek
- Seite 590 und 591:
Dazu ist eine Harmonisierung und Ko
- Seite 592 und 593:
auch vor dem Hintergrund der zukün
- Seite 594 und 595:
10.4.3.2 Austausch und Nutzung von
- Seite 596 und 597:
efindlichen Informationsbeständen
- Seite 598 und 599:
Hierdurch entstehen zwar zunächst
- Seite 600 und 601:
Pflanzen, müssen überprüfbar sei
- Seite 602 und 603:
eine Expositionsabschätzung durch
- Seite 604 und 605:
Öffentlichkeit durch den Zugang zu
- Seite 606 und 607:
Beudert, B., Breit, W., Höcker, L.
- Seite 608 und 609:
Doerpinghaus, A., Dröschmeister, R
- Seite 610 und 611:
Haines-Young, R., Potschin, M. (201
- Seite 612 und 613:
König, H. (2008): Biodiversität n
- Seite 614 und 615:
Raps, A. (2007): Umweltmonitoring v
- Seite 616 und 617:
Statistisches Bundesamt, BfN (Bunde
- Seite 618 und 619:
11 Ökologische Grenzen einhalten -
- Seite 620 und 621:
11.2 Die Einhaltung ökologischer G
- Seite 622 und 623:
„Die Erfordernisse des Umweltschu
- Seite 624 und 625:
11.2.3 Ökologische Grenzen in der
- Seite 626 und 627:
11.3 Politische Strategien als Inst
- Seite 628 und 629:
Tabelle 11-2 Beispiele für umweltr
- Seite 630 und 631:
11.3.3 Das Leitbild der „Green Ec
- Seite 632 und 633:
- Die Umwelt als ökonomische Resso
- Seite 634 und 635:
11.3.4 Analyse von Nachhaltigkeitss
- Seite 636 und 637:
688. Aus diesen Gründen bedarf es
- Seite 638 und 639:
zudem nicht angemessen erfasst, inw
- Seite 640 und 641:
Bewertung seitens der Bundesregieru
- Seite 642 und 643:
Vorhabens plausibel dargestellt sin
- Seite 644 und 645:
11.3.5 Analyse von Umweltstrategien
- Seite 646 und 647:
Zudem greift sich der Fahrplan die
- Seite 648 und 649:
Konkretisierung und politischen Akz
- Seite 650 und 651:
Individualverkehr kann auch bei Ein
- Seite 652 und 653:
- Sektorale Verantwortung für die
- Seite 654 und 655:
erücksichtigt werden. Insoweit hab
- Seite 656 und 657:
Bundes, die nunmehr vorsieht, dass
- Seite 658 und 659:
Es muss weiterhin die Aufgabe von N
- Seite 660 und 661:
11.6 Literatur Aden, H. (2012): Umw
- Seite 662 und 663:
Bundesregierung (2012): Nationale N
- Seite 664 und 665:
Europäische Kommission (2009): Lei
- Seite 666 und 667:
Jordan, A., Lenschow, A. (2010): En
- Seite 668 und 669:
Pierson, P. (1993): When Effect bec
- Seite 670 und 671:
SRU (2000): Umweltgutachten 2000. S
- Seite 672 und 673:
Abkürzungsverzeichnis AEG = Allgem
- Seite 674 und 675:
DG Env = Environment Directorate-Ge
- Seite 676 und 677:
Arbeitsorganisation IMA = Intermini
- Seite 678 und 679:
PFOA = Perfluoroctansäure PFOS = P
- Seite 680 und 681:
Stichwortverzeichnis Die Zahlenanga
- Seite 682 und 683:
Entflechtungsgesetz (327) Entkopplu
- Seite 684 und 685:
Integriertes Küstenzonenmanagement
- Seite 686 und 687:
Meeresschutz (8) - Herausforderunge
- Seite 688 und 689:
- Berichtspflichten (394) - Monitor
- Seite 690 und 691:
- Registrierung (10.3.4.1, 621, 626
- Seite 692 und 693:
- Steuerungsprobleme (11.1, 11.2, 1
- Seite 694 und 695:
- Offshore (447, 450, 468, 503, 505
- Seite 696 und 697:
Rechtsquellenverzeichnis 13. BImSch
- Seite 698 und 699:
ELER-Durchführungsverordnung Veror
- Seite 700 und 701:
2006 zum Schutz des Grundwassers vo
- Seite 702 und 703:
96/61/EG des Rates REACH-Verordnung
- Seite 704 und 705:
Verwaltungsstruktur-Reformgesetz Ba
- Seite 706 und 707:
§ 1 Bundesministerium für Umwelt,
- Seite 708 und 709:
§ 10 Der Sachverständigenrat für
- Seite 710 und 711:
Publikationsverzeichnis Umweltgutac
- Seite 712 und 713:
Deutsches Zentrum für Luft- und Ra
- Seite 714 und 715:
Nr. 3 Zur Einführung der Strategis
- Seite 716:
Mitglieder Sachverständigenrat fü