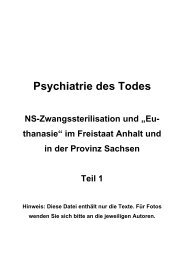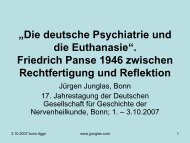Psychiatrie und Strafjustiz
Psychiatrie und Strafjustiz
Psychiatrie und Strafjustiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stellte von Liszt einen effizienten Rechtsgüterschutz ins Zentrum seines Reformkonzepts. 312 Seine Haupt-<br />
forderung bestand in einer Umgestaltung der Sanktionen, die einen optimalen Schutz der anerkannten<br />
Rechtsgüter wie Leben <strong>und</strong> Eigentum garantieren sollten: «Unsere Auffassung von der Strafe als Rechts-<br />
güterschutz verlangt nachweislich, dass im einzelnen Fall diejenige Strafe (nach Inhalt <strong>und</strong> Umfang) ver-<br />
hängt werde, welche notwendig ist, damit durch die Strafe die Rechtsgüterwelt geschützt ist.» 313 Das In-<br />
strument zur Gewährleistung des Rechtsgüterschutzes <strong>und</strong> zu einer wirksamen Bekämpfung des Verbre-<br />
chens sah von Liszt in einer Anpassung der Sanktionsformen an die Individualität der DelinquentInnen.<br />
Je nach Fall sollte die Strafe der «Besserung», der «Abschreckung» oder der «Unschädlichmachung» die-<br />
nen. 314<br />
Mit der Unterordnung dieser drei Strafzwecke unter die Funktion des Rechtsgüterschutzes <strong>und</strong> dem Ein-<br />
treten für eine Individualisierung des Strafrechts grenzte sich von Liszt bewusst von den Anhängern des<br />
traditionellen Schuldstrafrechts ab, die Strafen unabhängig von der Persönlichkeit der DelinquentInnen,<br />
das heisst allein unter Massgabe des Verschuldens <strong>und</strong> dem Gesichtspunkt der Wiederherstellung der<br />
Rechtsordnung verhängt wissen wollten. Zugleich knüpfte seine «Zweckstrafe» an die Tradition general-<br />
<strong>und</strong> spezialpräventiver Straftheorien an, wie sie von Feuerbach <strong>und</strong> Klein vertreten worden waren. 315 Die<br />
Forderung nach einer Preisgabe des Schuldstrafe zugunsten der «Zweckstrafe» stiess denn auch auf erbit-<br />
terten Widerstand seitens führender Vertreter der klassischen Strafrechtslehre wie Karl Binding (1841–<br />
1920) oder Karl Birkmeyer (1847–1920), die in Liszts «Zweckgedanke» eine gefährliche Unterminierung<br />
des Legalitätsprinzips sahen. 316 Dieser «Schulenstreit» bildete schliesslich den Hintergr<strong>und</strong> für die Reform<br />
des Reichsstrafgesetzbuchs, die 1902 von der deutschen Regierung in Angriff genommen wurde. 317<br />
Wie die Kriminalanthropologen sah von Liszt in der humanwissenschaftlichen Erfassung des «Verbre-<br />
chers» <strong>und</strong> der Klassifikation der Verbrechertypen eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame<br />
Kriminalpolitik. 318 Er ging davon aus, dass den unmittelbaren Strafzwecken, «Besserung», «Abschreckung»<br />
<strong>und</strong> «Unschädlichmachung», drei unterschiedliche Kategorien von StraftäterInnen entsprechen würden.<br />
312 Ihering, 1877, 476; Liszt, 1883, 22; Ehret, 1996, 120-126; Stolleis, 1989, 140.<br />
313 Liszt, 1883, 31.<br />
314 Liszt, 1883, 34.<br />
315 Vgl. Liszt, 1905b. In diesem Zusammenhang zu diskutieren ist die von Michel Foucault aufgestellte These, wonach es sich bei<br />
der Konzeption eines vom individuellen Verschulden unabhängigen strafrechtlichen Massnahmenrechts um eine Übertragung der<br />
zivilrechtlichen Kategorie der Kausalhaftung handle, wie sie etwa im Fall von Eisenbahn- oder Fabrikunfällen zum Tragen kam<br />
(Foucault, 1981, 418). Dieser diskurstheoretische Ansatz, der von einer Verschiebung der diskursiven Formation einer Gefährdungshaftung<br />
ohne Verschulden vom Zivil- ins Strafrecht ausgeht, ist von verschiedenen Autoren vertreten worden (Lemke,<br />
1997, 235; Andriopoulos, 1996, 84-86; Harris, 1989, 109-115). Als Beleg für diese Erklärung dienen in der Regel die Schriften der<br />
französischen <strong>und</strong> belgischen Juristen Raymond Saleilles <strong>und</strong> Adolphe Prins, die sich bei der Forderung nach einer Preisgabe des<br />
Schuldstrafrechts zugunsten eines Massnahmenrechts in der Tat auf das Prinzip der zivilrechtlichen Kausalhaftung beriefen<br />
(Prins, 1910, 50-58). In Bezug auf die Entwicklung in Deutschland <strong>und</strong> Italien ist der Erklärungsansatz einer «Austauschbewegung<br />
zwischen Zivil- <strong>und</strong> Strafrecht» (Stefan Andriopoulos) allerdings zu relativieren. So muss Andriopoulos, der Foucaults Ansatz<br />
ansonsten weitgehend folgt, einräumen, dass gerade von Liszt seine «Zweckstrafe» nicht aus der zivilrechtlichen Kausalhaftung<br />
ableitete (Andriopoulos, 1996, 85). Der Ansatz Foucaults vernachlässigt denn auch den Umstand, dass sichernde Massnahmen<br />
gegen «gemeingefährliche Individuen» im 19. Jahrh<strong>und</strong>erts auf der Ebene des Verwaltungsrechts, etwa im Zusammenhang mit<br />
Einweisungsbestimmungen in Irren- oder Zwangsarbeitsanstalten, bereits etabliert waren <strong>und</strong> dass zumindest in Deutschland eine<br />
ins 18. Jahrh<strong>und</strong>ert zurückgehende Tradition spezialpräventiver Straftheorien bestand, an welche die Reformer anknüpfen konnten.<br />
Deutsche <strong>und</strong> italienische Strafrechtsreformer wie von Liszt <strong>und</strong> Ferri knüpften bei der Entwicklung des strafrechtlichen<br />
Massnahmenrechts denn auch in erster Linie an die bestehenden administrativen Sicherungsmassregeln (Ferri, 1896, 330f.), respektive<br />
die spezialpräventive Tradition des Allgemeinen Landrechts an (Liszt, 1905b; Liszt 1905c, 367). Diese Präzisierung in<br />
Bezug auf die juristischen Konzepte schliesst nicht aus, dass Parallelen zwischen «Verbrechen» <strong>und</strong> «Eisenbahnunfällen», die eine<br />
vom individuellen Verschulden unabhängige gesellschaftliche Bewältigungsstrategien nahe legten, im zeitgenössischen Interdiskurs<br />
nicht sehr wohl hergestellt werden konnten (z.B. Aschaffenburg, 1912, 285).<br />
316 So etwa Birkmeyer in seiner 1907 erschienen Schrift Was lässt von Liszt vom Strafrecht übrig?<br />
317 Schmidt, 1995, 386-388, 394-399. Differenzierte Analysen des «Schulenstreits» liefern Bohnert, 1992 <strong>und</strong> Frommel, 1987.<br />
318 Vgl. Liszt, 1905, 291, 292, 297. Wie auch Kraepelin sah von Liszt den Verdienst der italienischen Kriminalanthropologen in<br />
erster Linie in der Konstituierung eines Wissensfelds über straffällig gewordene Individuen <strong>und</strong> in der Sensibilisierung der Justiz<br />
gegenüber der Individualität der DelinquentInnen; vgl. Liszt, 1905, 307.<br />
74