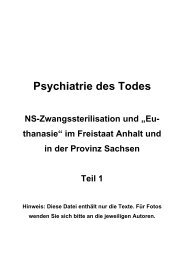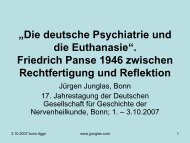- Seite 1 und 2:
Psychiatrie und Strafjustiz Entsteh
- Seite 3 und 4:
«Nehmen wir den Fall eines Mörder
- Seite 5 und 6:
6 Die Entwicklung der forensisch-ps
- Seite 7 und 8:
Vorwort Es gibt Schatten, die einen
- Seite 9 und 10:
lichkeiten der Psychiatrie, zur ges
- Seite 11 und 12:
einer «arbeitsteiligen Bewältigun
- Seite 13 und 14:
onen? Welche lebensweltlichen Bezü
- Seite 15 und 16:
en. 14 Sozialsysteme wie Gesellscha
- Seite 17 und 18:
soziale System selbst zur Komplexit
- Seite 19 und 20:
eine Subsumption systemrelevanter U
- Seite 21 und 22:
von festen Grenzziehung zwischen be
- Seite 23 und 24:
Ebene der Rechts- und Kriminalpolit
- Seite 25 und 26: Allgemeinärzten abzugrenzen versuc
- Seite 27 und 28: hender Konsens, dass für die Entst
- Seite 29 und 30: ihrer Kritik uneins waren. 89 Bis h
- Seite 31 und 32: insofern verpflichtet, als diese ma
- Seite 33 und 34: lediglich in einem Teil der Fälle
- Seite 35 und 36: Archiv für Neurologie und Psychiat
- Seite 37 und 38: 1. Teil: Das bürgerliche Strafrech
- Seite 39 und 40: nach einer Monopolisierung der Begu
- Seite 41 und 42: ten Strafe sollten potenzielle Stra
- Seite 43 und 44: keit wurde dabei definitiv von theo
- Seite 45 und 46: der individuellen Freiheit sowohl d
- Seite 47 und 48: eriefen sich in der Folge auf Metzg
- Seite 49 und 50: achtungen vor Gericht zu einem fest
- Seite 51 und 52: 1821 in Leipzig angeklagt, seine Ge
- Seite 53 und 54: désordre intellectuel ou moral; le
- Seite 55 und 56: Fazit: Das Paradox des bürgerliche
- Seite 57 und 58: Wie in der Einleitung erwähnt, ist
- Seite 59 und 60: konnte. Solche dégénérés supér
- Seite 61 und 62: liefen letztlich darauf hinaus, die
- Seite 63 und 64: Ursachen des Verbrechens einher. In
- Seite 65 und 66: (1851-1913) oder Gustav Aschaffenbu
- Seite 67 und 68: geistiger Normalität und Leistungs
- Seite 69 und 70: Gesetze» führen lasse, so stand d
- Seite 71 und 72: konzepts nach dem Zweiten Weltkrieg
- Seite 73 und 74: sie wegen der sittlichen Freiheit i
- Seite 75: stellte von Liszt einen effizienten
- Seite 79 und 80: Kriminalpolitik, deren Ziel in der
- Seite 81 und 82: Unabhängig von der Verwirklichung
- Seite 83 und 84: seits wichtige Voraussetzungen dars
- Seite 85 und 86: fern, wenn das eingeklagte Delikt a
- Seite 87 und 88: vom Bundesrat eingeleitete Gesetzge
- Seite 89 und 90: Strafe» glaube, definierte Stooss
- Seite 91 und 92: dürftig waren. Er beharrte denn au
- Seite 93 und 94: Strafrechtseinheit hatte zur Folge,
- Seite 95 und 96: Umgestaltung des geltenden Schuldst
- Seite 97 und 98: DelinquentInnen auch an die Irrenan
- Seite 99 und 100: meist auf Vererbung zurückgeführt
- Seite 101 und 102: zeigen sein wird, begrüsste Forel
- Seite 103 und 104: auf reges Interesse stiess. Von den
- Seite 105 und 106: Irrenanstalten zu entscheiden. 469
- Seite 107 und 108: Analoge Lern- und Annäherungsproze
- Seite 109 und 110: on eines Entwurfs für ein Irrenges
- Seite 111 und 112: Konsequenz eines rationellen Umgang
- Seite 113 und 114: Speyr verwies 1909 auf die Schwieri
- Seite 115 und 116: 4.3.1 Grenzziehungen zwischen Straf
- Seite 117 und 118: tragen liess. Die Strafe sollte in
- Seite 119 und 120: estimmung überhaupt leugnen und da
- Seite 121 und 122: dass auch bei einer medizinischen D
- Seite 123 und 124: tisch unannehmbar» abgelehnt hatte
- Seite 125 und 126: zugunsten der medizinischen Sachver
- Seite 127 und 128:
dafür, dass Verwahrungs- und Verso
- Seite 129 und 130:
wohl eine (verkürzte) Strafe, als
- Seite 131 und 132:
ärzte zu bringen und diese gleichz
- Seite 133 und 134:
Fazit: Sichernde Massnahmen als Ans
- Seite 135 und 136:
Forel wollte das Strafrecht durch e
- Seite 137 und 138:
2. Teil: Medikalisierungstendenzen
- Seite 139 und 140:
5 Das Dispositiv der forensisch-psy
- Seite 141 und 142:
Tat- und Schuldfragen, wozu auch di
- Seite 143 und 144:
eine grosse Zahl solcher Delinquent
- Seite 145 und 146:
ungen demzufolge in den «andern Gr
- Seite 147 und 148:
die nach wie vor desolaten sanitär
- Seite 149 und 150:
Rede. Unter einer solchen ist zu ve
- Seite 151 und 152:
falls viele Juristen angehörten. 6
- Seite 153 und 154:
gen zur Bildung und Entwicklung von
- Seite 155 und 156:
Störungen. 1895 wurde dieses Raste
- Seite 157 und 158:
6 Die Entwicklung der forensisch-ps
- Seite 159 und 160:
dagegen in forensisch-psychiatrisch
- Seite 161 und 162:
jedoch wieder um 44% zu. 726 Der An
- Seite 163 und 164:
eichen konnte. In der Gruppe der «
- Seite 165 und 166:
Bei den Männern machte die Gruppe
- Seite 167 und 168:
Auch Brandstifterinnen wurden etwas
- Seite 169 und 170:
Tabelle 5: Beurteilung der Zurechnu
- Seite 171 und 172:
lungsmuster. Im Gegenzug erhielten
- Seite 173 und 174:
7.1 Vorbemerkungen zur Quellenauswa
- Seite 175 und 176:
kann und der den involvierten Akteu
- Seite 177 und 178:
Tabelle 6: Zusammenstellung der Beg
- Seite 179 und 180:
Entscheide der Untersuchungsbehörd
- Seite 181 und 182:
Schwager: «Ich glaube, es fehlt ih
- Seite 183 und 184:
verständnis von Verteidigung und S
- Seite 185 und 186:
männisch die zeitgenössische Lehr
- Seite 187 und 188:
ten. Schliesslich reproduzierte das
- Seite 189 und 190:
Beobachtungen in der Irrenanstalt:
- Seite 191 und 192:
andInnen getestet werden. 833 Nach
- Seite 193 und 194:
sprach mit ihnen über die verschie
- Seite 195 und 196:
chen Strafrituale, die auf eine sym
- Seite 197 und 198:
Die Hintergründe der Tat: familiä
- Seite 199 und 200:
igkeit zu erklären, weshalb Bingge
- Seite 201 und 202:
werden konnten, nur auf einen «abn
- Seite 203 und 204:
senden) Bedarf seitens der Strafjus
- Seite 205 und 206:
kurz auf die Reorganisation der psy
- Seite 207 und 208:
Die Angehörigen brachten die beoba
- Seite 209 und 210:
gerechtfertigte Einweisung ins Arbe
- Seite 211 und 212:
habe er sich in einer «Remission»
- Seite 213 und 214:
schen Sachverständigen rückten. S
- Seite 215 und 216:
gut daher rühren, dass der Lehrer
- Seite 217 und 218:
die Berner Psychiater merken musste
- Seite 219 und 220:
Strafbarkeit seiner Handlung, das V
- Seite 221 und 222:
dieser Modifikation des herkömmlic
- Seite 223 und 224:
Die Ausweitung des Schwachsinnskonz
- Seite 225 und 226:
gerate. Wiederholt habe er Frau und
- Seite 227 und 228:
ten die Psychiater Zustände wie «
- Seite 229 und 230:
tungsmuster, die «minderwertigen A
- Seite 231 und 232:
te. 986 Ein «inneres Gleichgewicht
- Seite 233 und 234:
zu beleidigen [...].» Auch in sein
- Seite 235 und 236:
minderten Widerstandskraft» liess
- Seite 237 und 238:
Gewissermassen als männerspezifisc
- Seite 239 und 240:
Veranlagung; denn unzählige, von H
- Seite 241 und 242:
chungen beschäftigt. Wie Jörg Hut
- Seite 243 und 244:
verantwortlich. In den Augen der Ps
- Seite 245 und 246:
gleichgeschlechtlichen Neigungen zw
- Seite 247 und 248:
ung der straf- und zivilrechtlichen
- Seite 249 und 250:
der Zurechnungsfähigkeit] umso meh
- Seite 251 und 252:
Fazit: Thematisierung und Diskursiv
- Seite 253 und 254:
nutzen vermochten. Ebenfalls eine d
- Seite 255 und 256:
fern nachvollziehbar, als es sich b
- Seite 257 und 258:
chiatrische Modell der «vermindert
- Seite 259 und 260:
Rudolf W., bei dem die Psychiater e
- Seite 261 und 262:
Strafmasses zu. Es lag an ihr zu en
- Seite 263 und 264:
angeklagten BürgerInnen. Ärzte un
- Seite 265 und 266:
sisch-psychiatrische Begutachtungsp
- Seite 267 und 268:
Damit einher ging der in Kapitel 4
- Seite 269 und 270:
eim Regierungsrat sachbezüglichen
- Seite 271 und 272:
erwähnten Versuche von Strafrechts
- Seite 273 und 274:
Die staatliche Repression zielte me
- Seite 275 und 276:
allgemeinen Verhaltens [...]. Wenn
- Seite 277 und 278:
men der Strafrechtsdebatte befürch
- Seite 279 und 280:
Antragstellende Behörden und angeo
- Seite 281 und 282:
den Massnahmen nahm tendenziell ab,
- Seite 283 und 284:
S. präsentierte die Kumulation von
- Seite 285 und 286:
Ein Vergleich der Beschlüsse von 1
- Seite 287 und 288:
viel länger als die geschenkte Str
- Seite 289 und 290:
stand und den Charakter von Delinqu
- Seite 291 und 292:
«gefährliche» Charakter des Expl
- Seite 293 und 294:
ten sich in ihren Augen zu einem Bi
- Seite 295 und 296:
fung durch die Sachverständigen is
- Seite 297 und 298:
von Gottfried A. Zwar verneinte das
- Seite 299 und 300:
ExplorandInnen zu beurteilen. Wie d
- Seite 301 und 302:
3. Teil: Demedikalisierungs- und Au
- Seite 303 und 304:
Frage gestellt, wie sie die Auswirk
- Seite 305 und 306:
keineswegs unproblematisch, befürc
- Seite 307 und 308:
Geisteskranke» künftig verwahrt u
- Seite 309 und 310:
sehen. 1912 stellte Nationalrat Ste
- Seite 311 und 312:
acht. Eine 1918 unter der Leitung v
- Seite 313 und 314:
cher Regierung, den Ball auf die ei
- Seite 315 und 316:
wurden zu einer rein internen Angel
- Seite 317 und 318:
Auch diese Kantone akzentuierten je
- Seite 319 und 320:
angehalten werden. 1929 fasste Simo
- Seite 321 und 322:
chen würden in der Schweiz födera
- Seite 323 und 324:
Die deutsche Psychiatrie und die ve
- Seite 325 und 326:
Gehrys Argumentation war in mehrfac
- Seite 327 und 328:
Kurz nach Bleulers Vortrag von 1926
- Seite 329 und 330:
politische Pflicht der Sachverstän
- Seite 331 und 332:
Schwierigkeiten, die sich aus der s
- Seite 333 und 334:
tailberatungen der für die forensi
- Seite 335 und 336:
die auf ihrem Gebiete begangenen De
- Seite 337 und 338:
strafe zur Diskussion stand, Anlass
- Seite 339 und 340:
würde dann noch das unbefriedigend
- Seite 341 und 342:
streng moralisierende Sichtweise au
- Seite 343 und 344:
werden muss.» 1389 Wie Hoppeler be
- Seite 345 und 346:
10.2 Die Abstimmung über das Straf
- Seite 347 und 348:
das Beschwören der föderalistisch
- Seite 349 und 350:
notre vieux code pénal a une signi
- Seite 351 und 352:
des eidgenössische Gesetzes aus:
- Seite 353 und 354:
11 Demedikalisierungs- und Ausdiffe
- Seite 355 und 356:
den Juristen, Strafvollzugsbeamten
- Seite 357 und 358:
tenzstelle. 1945 erhielt Münsingen
- Seite 359 und 360:
Kritik am «flexiblen Berner Modell
- Seite 361 und 362:
Oberrichter sprach sich für das Be
- Seite 363 und 364:
setzbuch ein willkommenes Mittel zu
- Seite 365 und 366:
untergebracht wären, bei uns zu be
- Seite 367 und 368:
nen mit neuer Schärfe hervortreten
- Seite 369 und 370:
Ebenfalls auf der Ebene des Massnah
- Seite 371 und 372:
chung anzuordnen und nur er wird de
- Seite 373 und 374:
solche sozial ziemlich ungefährlic
- Seite 375 und 376:
fehlten es die Schweizer Psychiater
- Seite 377 und 378:
Die von Dukor im Bereich des Zivilr
- Seite 379 und 380:
Wissensvermittlung per Lehrbuch: Ja
- Seite 381 und 382:
Grundlagenreflexion und begrifflich
- Seite 383 und 384:
Bezeichnend für Binders Verständn
- Seite 385 und 386:
schwebte, war eine verwissenschaftl
- Seite 387 und 388:
isch untersuchten Häftlinge. 1950
- Seite 389 und 390:
tionen» auf die Gefangenschaft mei
- Seite 391 und 392:
fluss auf die Handlungsspielräume
- Seite 393 und 394:
zeigt, dass Otto Z. mit seinen Klag
- Seite 395 und 396:
Die Sprechstundenberichte dokumenti
- Seite 397 und 398:
homosexuellen Alfred M.: «Er ist e
- Seite 399 und 400:
spielräume einräumte, erlaubte, s
- Seite 401 und 402:
spruchs. In der Justizpraxis warf d
- Seite 403 und 404:
wie «verbrecherische Geisteskranke
- Seite 405 und 406:
geprägt, im Rahmen vorgegebener M
- Seite 407 und 408:
sche Modell der «verminderten Wide
- Seite 409 und 410:
unzurechnungsfähige und «gemeinge
- Seite 411 und 412:
die Schweizer Psychiater mit den Fo
- Seite 413 und 414:
funktionen wahrnahmen. Im Zeichen e
- Seite 415 und 416:
Verzeichnis der Tabellen und Grafik
- Seite 417 und 418:
Bestimmungen des Vorentwurfs von 19
- Seite 419 und 420:
Anhang 2: Statistische Übersichten
- Seite 421 und 422:
Tabelle 10: Übersicht über das in
- Seite 423 und 424:
Staatsarchiv des Kantons Zürich, Z
- Seite 425 und 426:
Binder, Hans (1945/46), «Über die
- Seite 427 und 428:
Forel, Auguste (1890), «Übergangs
- Seite 429 und 430:
Kraepelin, Emil (1887), Psychiatrie
- Seite 431 und 432:
Musil, Robert (1978), Der Mann ohne
- Seite 433 und 434:
[VE 1893] Motive zu dem Vorentwurf
- Seite 435 und 436:
Behrens, Ulrich (1999), «‹Sozial
- Seite 437 und 438:
Daniel, Ute (2000), «Erfahrung - (
- Seite 439 und 440:
Garland, David (1985), Punishment a
- Seite 441 und 442:
Hettling, Manfred (2000), «Die per
- Seite 443 und 444:
Labisch, Alfons (1992), Homo hygien
- Seite 445 und 446:
Möckli, Werner (1973), Schweizerge
- Seite 447 und 448:
Ritter, Hans Jakob (2000), «‹nic
- Seite 449 und 450:
Schwarz, E. (1954), «75 Jahre Kant
- Seite 451 und 452:
Vouilloz Burnier, Marie-France (199