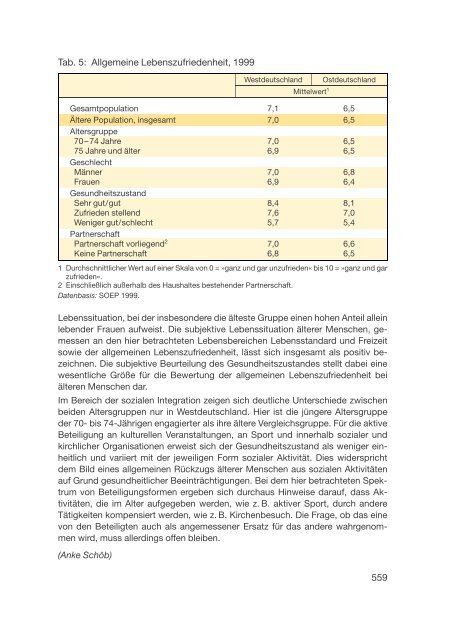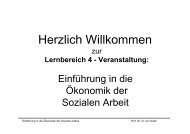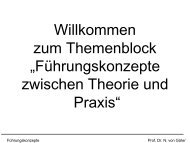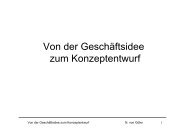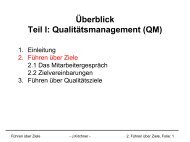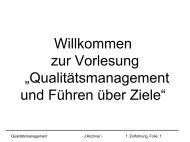- Seite 1 und 2:
Statistisches Bundesamt Datenreport
- Seite 3 und 4:
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) In
- Seite 5 und 6:
Inhalt Vorwort 15 Teil I: Gesellsch
- Seite 7 und 8:
7 Gesellschaftliche Mitwirkung 158
- Seite 9 und 10:
16 Preise und Verdienste 328 16.1 E
- Seite 11 und 12:
C Lebensbedingungen und ihre Bewert
- Seite 13 und 14:
15.2 Einstellungen zu in Deutschlan
- Seite 15:
Vorwort »In gut der Hälfte der Fa
- Seite 18 und 19:
Erläuterungen zur Umstellung von T
- Seite 20 und 21:
Dass man Statistiken weitestgehend
- Seite 22 und 23:
geleistet. Sie übermitteln ihre La
- Seite 24 und 25:
ilden, Kontrollfunktionen in der St
- Seite 26 und 27:
Noch Ansprechpartnerinnen . . . Sac
- Seite 28 und 29:
die Bildungs- und Beschäftigungsm
- Seite 30 und 31:
Abb. 1: Jährliche Bevölkerungszun
- Seite 32 und 33:
1.3 Die räumliche Bevölkerungsver
- Seite 34 und 35:
Tab. 5: Einwohnerzahlen und Bevölk
- Seite 36 und 37:
Abb. 5: Bevölkerung Deutschlands a
- Seite 38 und 39:
Tab. 7: Lebendgeborene und Gestorbe
- Seite 40 und 41:
Tab. 8: Mehrpersonenhaushalte 2000
- Seite 42 und 43:
Betrachtet man die nichtehelichen L
- Seite 44 und 45:
Abb. 7: Familienstand der Bevölker
- Seite 46 und 47:
Tab. 12: Ausländische Bevölkerung
- Seite 48 und 49:
dem seit Jahresbeginn 2000 geltende
- Seite 50 und 51:
Artikel 16 und Einführung von Arti
- Seite 52 und 53:
Im Jahr 1999 wurden 1,104 Mill. Wan
- Seite 54 und 55:
Im Jahr 1992 hatte die Zuwanderung
- Seite 56 und 57:
Abb. 1: Das Bildungssystem in Deuts
- Seite 58 und 59:
Deutschland eine Grundschule. Die A
- Seite 60 und 61:
geeignet, weil einerseits in diesem
- Seite 62 und 63:
Tab. 3: Ausländische Schülerinnen
- Seite 64 und 65:
achten. Nach einer Vorausschätzung
- Seite 66 und 67:
In den letzten Jahren suchten nicht
- Seite 68 und 69:
Tab. 7: Auszubildende 2000 Gebiet A
- Seite 70 und 71:
semester 2000/01 1,80 Mill. Studier
- Seite 72 und 73:
Tab. 12: Die zehn am stärksten bes
- Seite 74 und 75:
2.5.3 Frauenanteile Der hohe Bildun
- Seite 76 und 77:
Fortbildungs- und Umschulungsmaßna
- Seite 78 und 79:
Tab. 17: Allgemein bildender Schula
- Seite 80 und 81:
2.9 Bildungsausgaben Bildung ist ei
- Seite 82 und 83:
wird für den Besuch von Höheren F
- Seite 84 und 85:
schnittliche Beitrag zum Lebensunte
- Seite 86 und 87:
Abb. 1: Entwicklung von Erwerbstät
- Seite 88 und 89:
ganz oder zum Teil durch Angehörig
- Seite 90 und 91:
Abb. 3: Bevölkerung nach Alter und
- Seite 92 und 93:
Abb. 4: Erwerbstätige nach Wirtsch
- Seite 94 und 95:
Die Struktur der Erwerbstätigen na
- Seite 96 und 97:
unter den Selbstständigen und Beam
- Seite 98 und 99:
433 000 Menschen arbeitslos, was ei
- Seite 100 und 101:
Jahresdurchschnitt 1999 standen mit
- Seite 102 und 103:
Abb. 7: Jahresdurchschnittliche Erw
- Seite 104 und 105:
Grundsätzlich haben ältere Arbeit
- Seite 106 und 107:
ders schwer zu vermitteln waren in
- Seite 108 und 109:
Abb. 10: Nahaufnahme der Arbeitslos
- Seite 110 und 111:
auf 697 700. Nur wenigen Arbeitslos
- Seite 112 und 113:
aus, berücksichtigt die Transferle
- Seite 114 und 115:
ein monatliches Nettoeinkommen von
- Seite 116 und 117:
Nutzung eigener Wohnungen oder die
- Seite 118 und 119:
halte lag 1998 mit 228 Euro noch um
- Seite 120 und 121:
Tab. 5: Anteile der Konsumbereiche
- Seite 122 und 123:
eine Annäherung festzustellen. 199
- Seite 124 und 125:
im Bundesdurchschnitt um 51 % zunah
- Seite 126 und 127:
schnitt 134 Euro, ein Zweipersonenh
- Seite 128 und 129:
Geschirrspülmaschinen, Mikrowellen
- Seite 130 und 131:
Abb. 5: Ausstattung privater Hausha
- Seite 132 und 133:
den stationären Telefonen 2000 ebe
- Seite 134 und 135:
Tab. 2: Wohnungen in Wohngebäuden
- Seite 136 und 137:
Neubau von Wohnungen der Schwerpunk
- Seite 138 und 139:
Gas (37,1 %) aufgrund der schon erw
- Seite 140 und 141:
gediehen als in den neuen Ländern.
- Seite 142 und 143:
gebiet bezahlte etwa ein Drittel de
- Seite 144 und 145:
Für ein Drittel der Alleinlebenden
- Seite 146 und 147:
Tab. 13: Gebaute Wohnungen in den n
- Seite 148 und 149:
waren es 37 %. Damit hat sich gegen
- Seite 150 und 151:
den kann, gilt dies für die Freize
- Seite 152 und 153:
6.4.1 Theater In der Spielzeit 1998
- Seite 154 und 155:
Tab. 2: Museumsarten und Zahl der B
- Seite 156 und 157:
schriften, aber auch Schallplatten,
- Seite 158 und 159:
7 Gesellschaftliche Mitwirkung 7.1
- Seite 160 und 161:
F.D.P. Die GRÜNEN konnten erstmals
- Seite 162 und 163:
Tab. 2: Wahlbeteiligung und Stimmab
- Seite 164 und 165:
sammenfassend ist festzustellen, da
- Seite 166 und 167:
7.3 Engagement in Berufsverbänden
- Seite 168 und 169:
Abb. 4: 7.3.3 Arbeitgeberverbände
- Seite 170 und 171:
Betriebsräte können in Betrieben
- Seite 172 und 173:
Tab. 5: Katholische Kirche 1 Jahr M
- Seite 174 und 175:
ten 1999 die Christvespern und Mett
- Seite 176 und 177:
Tab. 1: Kranke und unfallverletzte
- Seite 178 und 179:
halte erfolgten wegen bös- und gut
- Seite 180 und 181:
unfälle. Insgesamt war etwa jeder
- Seite 182 und 183:
Abb. 2: Todesursachen 1999 in Proze
- Seite 184 und 185:
Tab. 6: Berufstätige Ärztinnen un
- Seite 186 und 187:
Während die gestiegenen Fallzahlen
- Seite 188 und 189:
Tab. 10: Schwerbehinderte am 31. 12
- Seite 190 und 191:
Die gesetzliche Krankenversicherung
- Seite 192 und 193:
Abb. 5: Einkommensleistungen 1998 n
- Seite 194 und 195:
Tab. 1: Leistungen des Sozialbudget
- Seite 196 und 197:
1,8 Mrd. Euro), umfassten zusammen
- Seite 198 und 199:
9.5 Gesetzliche Krankenversicherung
- Seite 200 und 201:
Abb. 3: Leistungsempfänger der soz
- Seite 202 und 203:
Euro gewesen. 1999 wurden von den G
- Seite 204 und 205:
Das Kindergeld für das erste, zwei
- Seite 206 und 207:
15 810 der Erziehungsurlaub in Ansp
- Seite 208 und 209:
Unter den 1,45 Mill. Haushalten, di
- Seite 210 und 211:
Tab. 11: Ausgaben und Einnahmen nac
- Seite 212 und 213:
Darüber hinaus wurden 20 100 Maßn
- Seite 214 und 215:
10 Rechtspflege 10.1 Einführung Ei
- Seite 216 und 217:
ichtsinstanzen überprüfen zu lass
- Seite 218 und 219:
Bundesgebiet 6 200 Straftaten je 10
- Seite 220 und 221:
Unterscheidet man zwischen kriminol
- Seite 222 und 223:
Tab. 6: Einsitzende in deutschen Ju
- Seite 224 und 225:
passung an die neue Abgrenzung des
- Seite 226 und 227:
Abb. 2: Nettoausgaben der öffentli
- Seite 228 und 229:
Tab. 3: Kassenmäßige Steuereinnah
- Seite 230 und 231:
Tab. 6: Einkommensverteilung 1995 n
- Seite 232 und 233:
Aufgabe des Länderfinanzausgleichs
- Seite 234 und 235:
entstehen zum größten Teil über
- Seite 236 und 237:
Bei den Dienststellen des öffentli
- Seite 238 und 239:
neren Sicherheit« (öffentliche Si
- Seite 240 und 241:
12 Gesamtwirtschaft im Überblick 1
- Seite 242 und 243:
in konstanten Preisen erweitert. Au
- Seite 244 und 245:
Tab 1: Bruttoinlandsprodukt Jahr In
- Seite 246 und 247:
Beträge in Mrd. Euro ausgewiesen u
- Seite 248 und 249:
Tab. 4: Verwendung des Bruttoinland
- Seite 250 und 251:
Tab. 6: Verteilung des Volkseinkomm
- Seite 252 und 253:
Vom gesamten Arbeitnehmerentgelt en
- Seite 254 und 255:
Tab. 9: Entwicklung von Wareneinfuh
- Seite 256 und 257:
lagen 2000 - wie auch in den Vorjah
- Seite 258 und 259:
Bei den Ausfuhrpreisen ist seit 197
- Seite 260 und 261:
Ausland getan wurde. Maßgeblicher
- Seite 262 und 263:
Dennoch ist der Anteil der Landwirt
- Seite 264 und 265:
50 Hektar. Die Anzahl der Betriebe,
- Seite 266 und 267:
(11,9 Mill. Hektar) der LF weisen d
- Seite 268 und 269:
13a.4.3 Mehr Saisonarbeitskräfte a
- Seite 270 und 271:
Tab. 6: Durchschnittliche Hektarert
- Seite 272 und 273:
vereinigung die Viehbestände deutl
- Seite 274 und 275:
die Erzeugung von Rind- und Kalbfle
- Seite 276 und 277:
Tab. 10: Betriebe mit Waldfläche 1
- Seite 278 und 279:
Danach gibt es in Deutschland rund
- Seite 280 und 281:
13b.2 Betriebe im ökologischen Lan
- Seite 282 und 283:
Abb. 7: Anbauflächen auf dem Acker
- Seite 284 und 285:
Abb. 8: Betriebe mit Viehhaltung 19
- Seite 286 und 287:
Öko-Betrieben niedriger als bei al
- Seite 288 und 289:
14 Produzierendes Gewerbe 14.1 Bede
- Seite 290 und 291:
14.2.2 Betriebe, Beschäftigte, Ums
- Seite 292 und 293:
14.2.3 Produktion Ab dem Jahr 1991
- Seite 294 und 295:
Tab. 6: Investitionen der Unternehm
- Seite 296 und 297:
streckt sich die Tätigkeit des Aus
- Seite 298 und 299:
personalintensiv sind, differieren
- Seite 300 und 301:
14.5 Handwerk Das Handwerk umfasst
- Seite 302 und 303:
Abb. 5: Die zehn bedeutendsten Gewe
- Seite 304 und 305:
15.2.1 Unternehmen und Beschäftigt
- Seite 306 und 307:
Die Gliederung der Unternehmensums
- Seite 308 und 309:
Abb. 4: Einzelhandelsumsätze 2000
- Seite 310 und 311:
Doch der Tourismus wird inzwischen
- Seite 312 und 313:
Die wichtigsten Reisemonate sind er
- Seite 314 und 315:
Übernachtungen nahmen im Jahr 2000
- Seite 316 und 317:
der Gästeübernachtungen findet in
- Seite 318 und 319:
Jahren nur unwesentlich gestiegen (
- Seite 320 und 321:
15.4 Banken Im Rahmen einer hoch en
- Seite 322 und 323:
ezahlte Freizeiten), Arbeitgeberbei
- Seite 324 und 325:
Tab. 9: Absatz und Umlauf von festv
- Seite 326 und 327:
Tab. 10: Selbstständig Erwerbstät
- Seite 328 und 329:
16 Preise und Verdienste 16.1 Einf
- Seite 330 und 331:
Abb. 1: Preisindex für die Lebensh
- Seite 332 und 333:
das frühere Bundesgebiet seit 1962
- Seite 334 und 335:
16.4 Preisindex für Wohngebäude,
- Seite 336 und 337:
Abb. 4: Preisveränderungen 2000 ge
- Seite 338 und 339:
Verdienstrelation mit den unterschi
- Seite 340 und 341:
Frauen, aber nur etwa ein Zehntel d
- Seite 342 und 343:
Die im Vergleich zu den Arbeitertä
- Seite 344 und 345:
Tab. 7 b: Bruttomonatsverdienste de
- Seite 346 und 347:
Tab 9: Durchschnittliche Nettomonat
- Seite 348 und 349:
Tab. 10: Arbeitskosten je Arbeitneh
- Seite 350 und 351:
men zu befriedigen und gleichzeitig
- Seite 352 und 353:
und Modernisierung des Schienennetz
- Seite 354 und 355:
Das »Anti-Stau-Programm 2003- 2007
- Seite 356 und 357:
Einwohner über 18 Jahre wird erwar
- Seite 358 und 359:
nen weitgehend Ausflugs- und Flussk
- Seite 360 und 361:
Tab. 8: Personenverkehr der Verkehr
- Seite 362 und 363:
zu wichtigen Liberalisierungsmaßna
- Seite 364 und 365:
Abb. 2: Güterverkehr der Verkehrsz
- Seite 366 und 367:
Abb. 3: Getötete je 1 Mill. Einwoh
- Seite 368 und 369:
18 Energie und Rohstoffe 18.1 Energ
- Seite 370 und 371:
Rohöl in Benzin oder Dieseltreibst
- Seite 372 und 373:
Tab. 2: Primärenergieverbrauch im
- Seite 374 und 375:
Abb. 1: Primärenergieverbrauch nac
- Seite 376 und 377:
Tab. 6: Endenergieverbrauch nach En
- Seite 378 und 379:
Tab. 7: Einfuhr von rohem Erdöl na
- Seite 380 und 381:
19 Umwelt 19.1 Umweltökonomische T
- Seite 382 und 383:
jährlich ein deutlich höherer Rü
- Seite 384 und 385:
ten Einsatzes von Umweltressourcen
- Seite 386 und 387:
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun
- Seite 388 und 389:
Der Verpackungsverbrauch gesamt lag
- Seite 390 und 391:
(im Durchschnitt etwa 1,25 %) in Fo
- Seite 392 und 393:
einheitlich erfasste und aussagekr
- Seite 394 und 395:
Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat
- Seite 396 und 397:
und auch eine vermutete Angleichung
- Seite 398 und 399:
echnet insgesamt 33,9 Mrd. Euro geg
- Seite 400 und 401:
Tab. 11: Neuzulassungen und Bestand
- Seite 402 und 403:
Die Schutzkategorie der Nationalpar
- Seite 404 und 405:
20 Deutschland und die Europäische
- Seite 406 und 407:
den. Regelmäßige Berichte der EU-
- Seite 408 und 409:
Zum Stichtag 1. Januar 1999 wurden
- Seite 410 und 411:
Agrarsubventionismus zurückdränge
- Seite 412 und 413:
ei die Bandbreite von 17 bzw. 22 Ei
- Seite 414 und 415:
20.6 Gesamtwirtschaftliche Entwickl
- Seite 416 und 417:
11 170 Euro auf. Der Wert für Deut
- Seite 418 und 419:
Tab. 8: Außenhandel 2000 Land Einf
- Seite 420 und 421:
leistungstransaktionen sowie der Ü
- Seite 422 und 423:
chen die Bruttoeinkommen mit 891 Eu
- Seite 424 und 425:
Die Autoren Die Autoren des Teils I
- Seite 426 und 427:
len, aber mehr noch stellt sich der
- Seite 428 und 429:
sellschaftspolitik« der Universit
- Seite 430 und 431:
mit Kollegen aus insgesamt 18 europ
- Seite 432 und 433:
Abb. 1: Die Zufriedenheit mit dem L
- Seite 434 und 435:
Die Lebenszufriedenheit der Mensche
- Seite 436 und 437:
als Ausdruck emotionalen Wohlergehe
- Seite 438 und 439:
fast keine Bedeutung. Diejenigen, d
- Seite 440 und 441:
Anfang der 90er-Jahre besonders hä
- Seite 442 und 443:
3 Zufriedenheit in Lebensbereichen
- Seite 444 und 445:
Tab. 1a: Anteile eher Zufriedener u
- Seite 446 und 447:
genannten Bereichen seit 1990 zu ei
- Seite 448 und 449:
(Realschulabschluss) und hinsichtli
- Seite 450 und 451:
Abb. 2: Veränderungen der Zufriede
- Seite 452 und 453:
deutschland seit diesem Zeitpunkt z
- Seite 454 und 455:
Tab. 1: Die Wichtigkeit von Lebensb
- Seite 456 und 457:
scher Einfluss) empirisch nachgewie
- Seite 458 und 459:
in der Vergangenheit, in der Zukunf
- Seite 460 und 461:
der Bundesrepublik und der eigenen
- Seite 462 und 463:
2000. Rentner sehen in beiden Teile
- Seite 464 und 465:
C Lebensbedingungen und ihre Bewert
- Seite 466 und 467:
Hier verbergen sich allerdings alte
- Seite 468 und 469:
Tab. 3: Lebensstandard in Deutschla
- Seite 470 und 471:
es neun Prozent der Bevölkerung, i
- Seite 472 und 473:
5.4 Zufriedenheit mit dem Lebenssta
- Seite 474 und 475:
6 Gesundheit Die Sicherstellung ein
- Seite 476 und 477:
wechsel vor allem die Kassen mit de
- Seite 478 und 479:
Tab. 3: Arztbesuche und durchschnit
- Seite 480 und 481:
internationalen Vergleich besonders
- Seite 482 und 483:
Die Bewegungen zwischen den Kassena
- Seite 484 und 485:
7.1 Berufliche Weiterbildung und Er
- Seite 486 und 487:
deutlich stärkere Rolle als in Wes
- Seite 488 und 489:
nicht verbessern«, und führt dies
- Seite 490 und 491:
Tab. 3b: Struktur der Maßnahmen zu
- Seite 492 und 493:
erhaltene Teilnahmebescheinigung »
- Seite 494 und 495:
8 Situation und Erwartungen auf dem
- Seite 496 und 497:
Tab. 1b: Arbeitsmarktbeteiligung in
- Seite 498 und 499:
Ostdeutschland aber auch arbeitslos
- Seite 500 und 501:
10 %) waren im Jahr 2000 der Ansich
- Seite 502 und 503:
sinkende Fertilitätsraten waren in
- Seite 504 und 505:
Tab. 1: Eigentumsstatus privater Ha
- Seite 506 und 507:
9.2 Wohnungsmieten In der DDR waren
- Seite 508 und 509: von Altbauten sind die durchschnitt
- Seite 510 und 511: Abb. 2: Verteilung der Bruttokaltmi
- Seite 512 und 513: Tab. 7: Einschätzung des Wohnumfel
- Seite 514 und 515: 10.1 Wahrgenommene Umweltbeeinträc
- Seite 516 und 517: 10.2 Zufriedenheit mit dem Zustand
- Seite 518 und 519: Tab. 2: Zufriedenheit mit dem Zusta
- Seite 520 und 521: entsprechende Anteil mit 27 % noch
- Seite 522 und 523: Tab. 3: Umweltrelevante Einstellung
- Seite 524 und 525: 11 Familie Unter einer Familie wird
- Seite 526 und 527: in einem gemeinsamen Haushalt. Dami
- Seite 528 und 529: Abb. 3: Der Anteil unverheirateter
- Seite 530 und 531: Abb. 5: Der Anteil nicht geschieden
- Seite 532 und 533: Tab. 4: Kinderwünsche West Ost in
- Seite 534 und 535: Tab. 1: Einstellungen zur Rolle der
- Seite 536 und 537: Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass
- Seite 538 und 539: Tab. 5: Stellenwert der Berufstäti
- Seite 540 und 541: zeigen die Daten, dass sich der Ant
- Seite 542 und 543: Abb. 1: Anteil der jungen Erwachsen
- Seite 544 und 545: Abb. 3: Anteil der jungen Erwachsen
- Seite 546 und 547: schaft bei den Nicht-Deutschen. Doc
- Seite 548 und 549: in den 90er-Jahren nahezu verdoppel
- Seite 550 und 551: engagieren und sportlich aktiv sind
- Seite 552 und 553: Tab. 1: Strukturmerkmale der älter
- Seite 554 und 555: Abb. 2: Wichtigkeit von Lebensberei
- Seite 556 und 557: 9 % der westdeutschen und 3 % der o
- Seite 560 und 561: 15 Einstellungen zur Zuwanderung un
- Seite 562 und 563: Tab. 2: Befürwortung der völligen
- Seite 564 und 565: ses Ziel weitgehend Konsens -, als
- Seite 566 und 567: Abb. 3: Diskriminierende Einstellun
- Seite 568 und 569: Tab. 4: Kontakte zu in Deutschland
- Seite 570 und 571: D Sozialstruktur 16 Soziale Schicht
- Seite 572 und 573: erheblichen Teil der ehemals Erwerb
- Seite 574 und 575: Tab. 2: Indikatoren der objektiven
- Seite 576 und 577: ungen finden sich in Westdeutschlan
- Seite 578 und 579: der Mittelschicht. Auch der Anteil
- Seite 580 und 581: 17 Einkommensverteilung und Armut M
- Seite 582 und 583: Tab. 1: Haushaltsnettoeinkommen der
- Seite 584 und 585: Anstieg der Ungleichheit, der sich
- Seite 586 und 587: der 50-%-Schwelle hat sich in Deuts
- Seite 588 und 589: mutspopulation [FGT(2)] gewichtet s
- Seite 590 und 591: Tab. 5b: Betroffenheit von Armut un
- Seite 592 und 593: neren Großstädten. Mieter sind we
- Seite 594 und 595: Tab. 6: Einkommensdynamik: Quintils
- Seite 596 und 597: sonen sind mehr oder weniger perman
- Seite 598 und 599: 18.1 Politisches Interesse und poli
- Seite 600 und 601: gleichbare Entwicklung hat auch die
- Seite 602 und 603: Tab. 1: Mitgliedschaft in Organisat
- Seite 604 und 605: knapp vier Prozentpunkte unter dem
- Seite 606 und 607: Tab. 2: Vertretungsgefühl von Mitg
- Seite 608 und 609:
grundsätzlich als die beste Staats
- Seite 610 und 611:
völkerungsgruppen relativ ähnlich
- Seite 612 und 613:
Kernbereichen nur unwesentlich unte
- Seite 614 und 615:
Dieses Muster existierte bereits im
- Seite 616 und 617:
F Deutschland und Europa 20 Lebensb
- Seite 618 und 619:
in Slowenien geben zudem rund drei
- Seite 620 und 621:
eobachten. In Ungarn reichen die Pr
- Seite 622 und 623:
Außer in Ungarn sind die Bürger m
- Seite 624 und 625:
21 Sozialer Zusammenhalt in europä
- Seite 626 und 627:
Slowenen. Auch bei den übrigen Kon
- Seite 628 und 629:
indung wahrgenommen werden. Acht vo
- Seite 630 und 631:
Tab. 4: Kriminalitätsbelastung und
- Seite 632 und 633:
Stichwortverzeichnis Kursiv gesetzt
- Seite 634 und 635:
Einfuhr 252 ff., 275 Einfuhrpreise
- Seite 636 und 637:
Integration s.a. Ausländer - polit
- Seite 638 und 639:
Schulabschluss 61, 78 f. Schulden
- Seite 640:
- Freizeit 442 ff., 451, 547 - gese