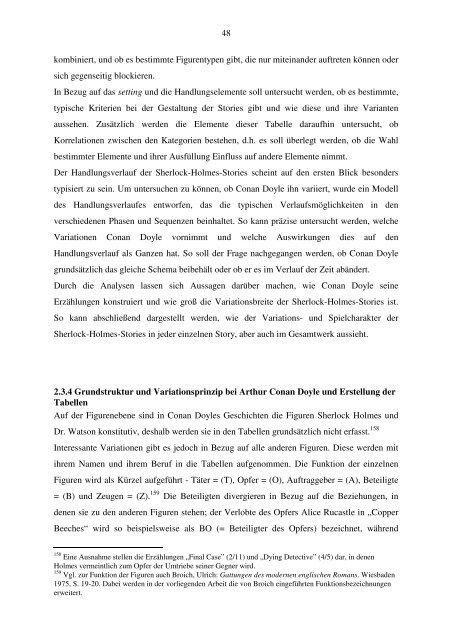- Seite 1 und 2: Schema und Variation in den Sherloc
- Seite 3 und 4: Meinen geliebten Eltern, Angelika u
- Seite 5 und 6: 3.1.4 Ergebnisse der Auswertung der
- Seite 7 und 8: 2 Spielcharakter der Kriminallitera
- Seite 9 und 10: 4 sah man die vier oberen Fächer d
- Seite 11 und 12: 6 und eine wollüstige Erleichterun
- Seite 13 und 14: 8 funktionieren. Abwertend sind die
- Seite 15 und 16: 10 Kriminalliteratur, nämlich auf
- Seite 17 und 18: 12 Spiels genannt werden, einander
- Seite 19 und 20: 14 ausgelösten Emotionen, wie Horr
- Seite 21 und 22: 16 verschiedene Figuren: den Butler
- Seite 23 und 24: 18 Musik und dem Kriminalschema an,
- Seite 25 und 26: 20 einen durch Bearbeitung der vorh
- Seite 27 und 28: 22 1.2.3 Ein Modell zur Untersuchun
- Seite 29 und 30: 24 2. Die Sherlock-Holmes-Stories:
- Seite 31 und 32: 26 Geht man, wie oben beschrieben,
- Seite 33 und 34: 28 It is my design to render it man
- Seite 35 und 36: 2.1.3 Spielcharakter und Grundschem
- Seite 37 und 38: 32 wird, dass der Leser gleichberec
- Seite 39 und 40: 34 technische, mathematische Sprach
- Seite 41 und 42: 36 2.1.3.3 „The Purloined Letter
- Seite 43 und 44: 38 2.2 Fazit: Poes Spielregeln der
- Seite 45 und 46: 40 Doyle als „Variationskünstler
- Seite 47 und 48: 42 Schklovskij und Knight ihre Betr
- Seite 49 und 50: 1. Analyse in der Baker Street, die
- Seite 51: 46 „A Scandal in Bohemia“; „T
- Seite 55 und 56: 50 Hinweise gar nicht gegeben werde
- Seite 57 und 58: 52 Story „Scandal in Bohemia“ h
- Seite 59 und 60: 54 gehören beispielsweise Wilson a
- Seite 61 und 62: 56 Aussteiger eines hermetischen Zi
- Seite 63 und 64: 58 It is a paradox of these stories
- Seite 65 und 66: Typ M.I.1: Der „professionelle Ve
- Seite 67 und 68: 62 („Blue Carbuncle“ (1/7)), de
- Seite 69 und 70: 64 rühmen. Durch diese Erzählweis
- Seite 71 und 72: 66 besorgter Mann war, der den Entf
- Seite 73 und 74: 68 Eine leichte Abwandlung des Poli
- Seite 75 und 76: 70 John Horner („Blue Carbuncle
- Seite 77 und 78: 72 Existenz im Hintergrund wird die
- Seite 79 und 80: 74 Sherlock-Holmes-Stories oftmals
- Seite 81 und 82: 76 beispielsweise Manfred in Walpol
- Seite 83 und 84: 78 erlebten und sahen, eine mysteri
- Seite 85 und 86: 80 Problem: Die anfängliche erotis
- Seite 87 und 88: Nebenfiguren ohne Kategorisierung 8
- Seite 89 und 90: 84 Joseph Harrison aus „Naval Tre
- Seite 91 und 92: 86 ein weiteres Geheimnis birgt und
- Seite 93 und 94: 88 verspricht, für den halben Lohn
- Seite 95 und 96: 90 Wie im Falle der Figur Eccles sc
- Seite 97 und 98: 92 [...] His dress was rich in a ri
- Seite 99 und 100: 94 stellt so symbolisch den Kampf v
- Seite 101 und 102: 96 gentle voice, and the air of rom
- Seite 103 und 104:
98 Abenteuerlichen und erinnert an
- Seite 105 und 106:
100 villain (Typ M.I.10) entwickelt
- Seite 107 und 108:
102 die Aussagen des Jungen beim Va
- Seite 109 und 110:
104 Well, his position is unique. H
- Seite 111 und 112:
106 „Shrinking job opportunities
- Seite 113 und 114:
108 wurde 272 . „The sexual aspec
- Seite 115 und 116:
110 Kitty Winter aus „Illustrious
- Seite 117 und 118:
112 Aus Abhängigkeit von seiner Ge
- Seite 119 und 120:
Typ W.I.4: Frau mit Geheimnis 114 D
- Seite 121 und 122:
116 Durch das patriarchalische Syst
- Seite 123 und 124:
118 Die drei Cushing-Schwestern aus
- Seite 125 und 126:
120 - Gefängnis kann nur durch den
- Seite 127 und 128:
122 Wiederum kann nur der Meisterde
- Seite 129 und 130:
124 Her face, too, was streaked wit
- Seite 131 und 132:
126 von Männern unabhängigeren Ty
- Seite 133 und 134:
128 Figuren wird deutlich, dass all
- Seite 135 und 136:
130 Ihr Ungehorsam und ihre Auflehn
- Seite 137 und 138:
132 ihrem Vorteil und zu ihrer Lust
- Seite 139 und 140:
134 Arbeitsrechte in ihrer Stellung
- Seite 141 und 142:
136 Im Kontrast zur Theorie der erh
- Seite 143 und 144:
138 ihrer Macht betrachtete Queen V
- Seite 145 und 146:
Typ W.I.1 Dienstmädchen/Haushälte
- Seite 147 und 148:
142 Erzählung interessante andere
- Seite 149 und 150:
144 5. atypische Figuren werden vom
- Seite 151 und 152:
146 Kunsthändler (3/8), Afrikafors
- Seite 153 und 154:
148 In der viktorianischen Literatu
- Seite 155 und 156:
150 sehr ambivalent, und viele der
- Seite 157 und 158:
152 Interessant ist in Bezug auf di
- Seite 159 und 160:
154 fortschrittlicher und aufgeklä
- Seite 161 und 162:
156 Stadt begangen werden. Neben Mo
- Seite 163 und 164:
158 Unterschied dazu gehörten die
- Seite 165 und 166:
160 spielen 16 Erzählungen. 460 De
- Seite 167 und 168:
162 gegenüber der ländlichen Bev
- Seite 169 und 170:
164 Noch zu Beginn des 19. Jahrhund
- Seite 171 und 172:
166 oder einem rätselhaften Vorfal
- Seite 173 und 174:
a. Verbrechen 168 Diebstahl: „Ber
- Seite 175 und 176:
170 Konstruktion gleich mehrere Fra
- Seite 177 und 178:
172 Das Messer ist ein typisches Mo
- Seite 179 und 180:
174 versuchte Mord an Lady Frances
- Seite 181 und 182:
3.2.1.5 Clues 176 Sherlock Holmes t
- Seite 183 und 184:
178 Während sich in Europa generel
- Seite 185 und 186:
180 wissenschaftliche Arbeiten gest
- Seite 187 und 188:
182 die Hintergründe des Falles li
- Seite 189 und 190:
184 werden clues entweder mit red h
- Seite 191 und 192:
186 In den Erzählungen „Noble Ba
- Seite 193 und 194:
188 3.2.1.7 Irreführung des Lesers
- Seite 195 und 196:
190 Raffiniertere Formen der misdir
- Seite 197 und 198:
192 Lösung eng aufeinander bezogen
- Seite 199 und 200:
194 Während im Thriller, in dem si
- Seite 201 und 202:
196 Geistererscheinungen wahrgenomm
- Seite 203 und 204:
198 Lodge“ (4/1) und „Blanched
- Seite 205 und 206:
200 der Furcht übergeht: das vor A
- Seite 207 und 208:
202 Demaskierung, der das rasante E
- Seite 209 und 210:
Typ1: Auflauern in der Dunkelheit 2
- Seite 211 und 212:
206 Das zentrale Spannungsmoment de
- Seite 213 und 214:
208 vermuten, dass die Herausgeber
- Seite 215 und 216:
210 Diebstahl seit Beginn des 19. J
- Seite 217 und 218:
212 Hinrichtungen wegen Delikten wi
- Seite 219 und 220:
214 werden kann, in „Thor Bridge
- Seite 221 und 222:
216 dieses Milieu, während sich zw
- Seite 223 und 224:
218 Spannungselemente wie Verfolgun
- Seite 225 und 226:
220 Unterhaltungselemente werden in
- Seite 227 und 228:
222 Dabei behält Conan Doyle die E
- Seite 229 und 230:
224 1. Thematisierung oder Markieru
- Seite 231 und 232:
226 So wird die 1. Phase des Rätse
- Seite 233 und 234:
228 Durch diese Form der Einleitung
- Seite 235 und 236:
230 In der Reflexphase erläutern d
- Seite 237 und 238:
232 Am Tatort untersuchen die Detek
- Seite 239 und 240:
234 zu einer Blockierung der Aufkl
- Seite 241 und 242:
236 einem Trick. Wie die Handlung,
- Seite 243 und 244:
238 - im Gegensatz zu den ersten be
- Seite 245 und 246:
240 Zu Typ 1b des Handlungsverlaufs
- Seite 247 und 248:
Typ 1a (1/1): Handlungsverlauf 242
- Seite 249 und 250:
244 Interessanterweise gibt es kein
- Seite 251 und 252:
Typ 2a (1/5): Handlungsverlauf 246
- Seite 253 und 254:
Typ 2b (1/6): Handlungsverlauf 248
- Seite 255 und 256:
250 Es ist ersichtlich, dass die Va
- Seite 257 und 258:
252 Holmes im Sterben zu liegen sch
- Seite 259 und 260:
Typ 3a (5/10): Handlungsverlauf 254
- Seite 261 und 262:
256 Typ 3b/Extremvarianten (5/2): H
- Seite 263 und 264:
258 Story erlebt wird, ebenfalls vo
- Seite 265 und 266:
260 Ermittlung wird hier durch mehr
- Seite 267 und 268:
262 Holmes-Stories stärker variier
- Seite 269 und 270:
264 3.4 Abschließende Bemerkungen
- Seite 271 und 272:
266 er so das Erfolgsrezept seines
- Seite 273 und 274:
268 festgestellt werden konnten. Sc
- Seite 275 und 276:
270 3.5 Gegenprobe: Ein Vergleich m
- Seite 277 und 278:
272 wie in der hier untersuchten St
- Seite 279 und 280:
274 kurz darauf in einem Überrasch
- Seite 281 und 282:
276 Fall durch die Augen des Opfers
- Seite 283 und 284:
278 besitzt, die in der konservativ
- Seite 285 und 286:
280 Stadt spielt bei Conan Doyle vo
- Seite 287 und 288:
282 Schklovskij stellte die These a
- Seite 289 und 290:
284 eine neue Zielgruppe als Publik
- Seite 291 und 292:
286 Geschichten konnten - entsprech
- Seite 293 und 294:
288 Schon oben 702 wurde auf das ho
- Seite 295 und 296:
290 4.3 Schema und Variation in den
- Seite 297 und 298:
292 Detektivgeschichte, wie es Cona
- Seite 299 und 300:
294 dabei aber trotzdem sehr variab
- Seite 301 und 302:
296 Anz, Thomas: Literatur und Lust
- Seite 303 und 304:
298 Braddon, Mary Elizabeth: Lady A
- Seite 305 und 306:
300 Clausen, Christopher: „Sherlo
- Seite 307 und 308:
302 Fernando, Lloyd: „New Women
- Seite 309 und 310:
304 Heermann, Christian: Der Würge
- Seite 311 und 312:
306 Koch, Walter A.: The Biology of
- Seite 313 und 314:
308 Nünning, Ansgar/Jahn, Manfred:
- Seite 315 und 316:
310 Rosenheim, Shawn/Rachman, Steph
- Seite 317 und 318:
Stoker, Bram: Dracula. Ware 1993. 3
- Seite 319 und 320:
314 Wilson, Evan M.: „Sherlock Ho
- Seite 321 und 322:
Stipendien 09/1999 - 09/2002 Promot
- Seite 323 und 324:
Inhaltsverzeichnis Seite Anhang I:
- Seite 325 und 326:
Typ W.II.1 = „angel in the house
- Seite 327 und 328:
Kommentar: 2 Die Geschichte ist ein
- Seite 329 und 330:
4 element ist der Feueralarm nicht
- Seite 331 und 332:
Kommentar: 6 Die Handlung weist zu
- Seite 333 und 334:
1. Figuren männlich weiblich Beruf
- Seite 335 und 336:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 337 und 338:
3. Handlungsverlauf 12 1. Einleitun
- Seite 339 und 340:
The Adventures of Sherlock Holmes:
- Seite 341 und 342:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 343 und 344:
3. Handlungsverlauf 18 1. Einleitun
- Seite 345 und 346:
The Adventures of Sherlock Holmes:
- Seite 347 und 348:
22 Kolonialmotiv wird in dieser Erz
- Seite 349 und 350:
24 selbstverständlich erfolgreich
- Seite 351 und 352:
Kommentar: 26 Die Handlung weist ei
- Seite 353 und 354:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 355 und 356:
30 Holmes will Captain Calhoun eine
- Seite 357 und 358:
Kommentar: 32 Der Variationsgrad li
- Seite 359 und 360:
34 Familie „verdient“. Um seine
- Seite 361 und 362:
Kommentar: 36 Neben dem typischen L
- Seite 363 und 364:
Variationsgrad Handlungsverlauf: 38
- Seite 365 und 366:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 367 und 368:
Kommentar: 42 Der Schauplatz der Er
- Seite 369 und 370:
Kommentar: 44 Der Handlungsverlauf
- Seite 371 und 372:
46 das Julia gehört hat, stammt vo
- Seite 373 und 374:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 375 und 376:
3. Handlungsverlauf 50 1. Einleitun
- Seite 377 und 378:
The Adventures of Sherlock Holmes:
- Seite 379 und 380:
54 In der Figur des Colonel Lysande
- Seite 381 und 382:
56 gewesen sein muss, denn die Szen
- Seite 383 und 384:
Kommentar: 58 Die Handlung weist ei
- Seite 385 und 386:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 387 und 388:
Variationsgrad setting/Handlungsele
- Seite 389 und 390:
Kommentar: 64 Die Handlung einen mi
- Seite 391 und 392:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 393 und 394:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 395 und 396:
3. Handlungsverlauf 70 1. Einleitun
- Seite 397 und 398:
The Adventure os Sherlock Holmes:
- Seite 399 und 400:
Kommentar: 74 Die Hauptfiguren Viol
- Seite 401 und 402:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 403 und 404:
Kommentar: 78 Die Handlung verläuf
- Seite 405 und 406:
80 Vier Tage später treffen sich H
- Seite 407 und 408:
82 und Hof, dass sie nicht bemerkt,
- Seite 409 und 410:
84 sowie die unheimliche Moorlandsc
- Seite 411 und 412:
Variationsgrad Handlungsverlauf: 86
- Seite 413 und 414:
1. Tabelle: Figuren männlich weibl
- Seite 415 und 416:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 417 und 418:
3. Handlungsverlauf 92 1. Einleitun
- Seite 419 und 420:
The Memoirs of Sherlock Holmes: „
- Seite 421 und 422:
96 einer unsinnigen Tätigkeit nach
- Seite 423 und 424:
3. Handlungsverlauf 98 1. Einleitun
- Seite 425 und 426:
100 The Memoirs of Sherlock Holmes:
- Seite 427 und 428:
1. Tabelle Figuren 102 männlich we
- Seite 429 und 430:
104 Im Gegensatz zu dieser außerge
- Seite 431 und 432:
3. Handlungsverlauf 106 1. Einleitu
- Seite 433 und 434:
Erzähltechnik/ discourse: Variatio
- Seite 435 und 436:
Kommentar: 110 Reginald Musgrave is
- Seite 437 und 438:
112 Präsentieren des Schatzes, den
- Seite 439 und 440:
Kommentar: 114 Wie in „Gloria Sco
- Seite 441 und 442:
116 Bibliothek eingebrochen waren,
- Seite 443 und 444:
118 Mit der Figur des Kutschers Wil
- Seite 445 und 446:
120 Erkenntnisse hat Holmes auch be
- Seite 447 und 448:
Variationsgrad Handlungsverlauf: 12
- Seite 449 und 450:
124 sich den Kopf tödlich am Kamin
- Seite 451 und 452:
Kommentar: 126 Auch die vorliegende
- Seite 453 und 454:
128 Unterhaltungselemente liegen ni
- Seite 455 und 456:
Kommentar: 130 Die Erzählung weist
- Seite 457 und 458:
132 Täter Mitglieder einer Bankrä
- Seite 459 und 460:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 461 und 462:
Kommentar: 136 Die Handlung verläu
- Seite 463 und 464:
138 Kratides informiert, der sofort
- Seite 465 und 466:
Kommentar: 140 Mycroft Holmes ist w
- Seite 467 und 468:
142 noch in der Geschichte „Retir
- Seite 469 und 470:
Kommentar: 144 Durch den Besuch der
- Seite 471 und 472:
146 am Bahnhof um und hält die bei
- Seite 473 und 474:
148 Holdhurst, für die Regierung t
- Seite 475 und 476:
Kommentar: 150 Viele der in dieser
- Seite 477 und 478:
Kommentar: 152 Die Handlung nimmt e
- Seite 479 und 480:
1. Tabelle Figuren 154 männlich we
- Seite 481 und 482:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 483 und 484:
3. Handlungsverlauf 158 1. Einleitu
- Seite 485 und 486:
160 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 487 und 488:
162 Colonel Moran ist ein ehemalige
- Seite 489 und 490:
3. Handlungsverlauf 164 1. Einleitu
- Seite 491 und 492:
166 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 493 und 494:
Kommentar: 168 Wie James McCarthy a
- Seite 495 und 496:
3. Handlungsverlauf 170 1. Einleitu
- Seite 497 und 498:
172 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 499 und 500:
Kommentar: 174 Viele der Elemente d
- Seite 501 und 502:
3. Handlungsverlauf 176 1. Einleitu
- Seite 503 und 504:
178 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 505 und 506:
180 ihres Arbeitgebers mit verstör
- Seite 507 und 508:
182 die Verbrecher werden der Poliz
- Seite 509 und 510:
Kommentar: 184 Die Handlung weist m
- Seite 511 und 512:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 513 und 514:
188 seines jüngeren Sohnes dessen
- Seite 515 und 516:
190 Wirtshauses und die unheimliche
- Seite 517 und 518:
Kommentar: 192 Der Handlungsverlauf
- Seite 519 und 520:
1. Tabelle Figuren 194 männlich we
- Seite 521 und 522:
196 Kommentar: Der Schauplatz, ein
- Seite 523 und 524:
Kommentar: 198 Die Handlung weist e
- Seite 525 und 526:
200 berühmten Adligen und Staatsma
- Seite 527 und 528:
202 Mrs. Ronder in „Veiled Lodger
- Seite 529 und 530:
3. Handlungsverlauf 204 1. Einleitu
- Seite 531 und 532:
206 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 533 und 534:
Variationsgrad Figuren: 208 _ _____
- Seite 535 und 536:
3. Handlungsverlauf 210 1. Einleitu
- Seite 537 und 538:
212 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 539 und 540:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 541 und 542:
Kommentar: 216 Der Handlungsverlauf
- Seite 543 und 544:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 545 und 546:
220 Auslöser für das Verbrechen i
- Seite 547 und 548:
3. Handlungsverlauf 222 1. Einleitu
- Seite 549 und 550:
224 The Return of Sherlock Holmes:
- Seite 551 und 552:
226 besonders merkwürdig verhalten
- Seite 553 und 554:
228 Fähigkeiten zu tun haben könn
- Seite 555 und 556:
Kommentar: 230 Der Handlungsverlauf
- Seite 557 und 558:
232 wollte, erklärt, dass Kapitän
- Seite 559 und 560:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 561 und 562:
Kommentar: 236 Die Handlung weist e
- Seite 563 und 564:
238 eine Ohnmacht vor. Bevor Sir Tr
- Seite 565 und 566:
240 personifizieren den Typ der hei
- Seite 567 und 568:
3. Handlungsverlauf 242 1. Einleitu
- Seite 569 und 570:
244 His Last Bow: „The Adventure
- Seite 571 und 572:
246 and conventional to the last de
- Seite 573 und 574:
248 sind aber auch die höchsten po
- Seite 575 und 576:
Kommentar: 250 Der Handlungsverlauf
- Seite 577 und 578:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 579 und 580:
254 Bei Betrachtung aller Faktoren
- Seite 581 und 582:
3. Handlungsverlauf 256 1. Einleitu
- Seite 583 und 584:
258 His Last Bow: „The Adventure
- Seite 585 und 586:
260 Mrs. Lucca wird wie viele ander
- Seite 587 und 588:
3. Handlungsverlauf 262 1. Einleitu
- Seite 589 und 590:
264 His Last Bow: „The Bruce-Part
- Seite 591 und 592:
266 verloren wäre. Mycroft Holmes
- Seite 593 und 594:
Kommentar: 268 Das setting ist - wi
- Seite 595 und 596:
Variationsgrad Handlungsverlauf: 27
- Seite 597 und 598:
1. Tabelle Figuren männlich weibli
- Seite 599 und 600:
Kommentar setting/Handlungselemente
- Seite 601 und 602:
276 die typischen Phasen 2, 3 und 4
- Seite 603 und 604:
1. Tabelle: Figuren männlich weibl
- Seite 605 und 606:
280 einzige Frau in den Sherlock-Ho
- Seite 607 und 608:
3. Handlungsverlauf 282 1. Einleitu
- Seite 609 und 610:
284 His Last Bow: „The Adventure
- Seite 611 und 612:
Kommentar: 286 Der Auftraggeber Mr.
- Seite 613 und 614:
288 Holmes und Watson zwar, wie hä
- Seite 615 und 616:
Kommentar: 290 Der Handlungsverlauf
- Seite 617 und 618:
1. Tabelle Figuren 292 männlich we
- Seite 619 und 620:
Kommentar: 294 Viele Elemente der v
- Seite 621 und 622:
Kommentar: 296 Der Handlungsverlauf
- Seite 623 und 624:
298 Verlassen Damerys erkennt Watso
- Seite 625 und 626:
Kommentar: 300 Die Erzählung „Il
- Seite 627 und 628:
Variationsgrad setting/Handlungsele
- Seite 629 und 630:
Kommentar: 304 Im Modell lässt sic
- Seite 631 und 632:
1. Tabelle Figuren 306 männlich we
- Seite 633 und 634:
Variationsgrad setting/Handlungsele
- Seite 635 und 636:
Kommentar: 310 Die Erzählungen „
- Seite 637 und 638:
1. Tabelle Figuren 312 männlich we
- Seite 639 und 640:
Variationsgrad setting/Handlungsele
- Seite 641 und 642:
Kommentar: 316 Der Handlungsverlauf
- Seite 643 und 644:
318 versuchte Isadora Klein alles,
- Seite 645 und 646:
320 hardest to face.“ 750 Die Bes
- Seite 647 und 648:
3. Handlungsverlauf 322 1. Einleitu
- Seite 649 und 650:
324 The Case-Book of Sherlock Holme
- Seite 651 und 652:
326 Die Figur der Mrs. Ferguson ste
- Seite 653 und 654:
328 die lahmenden Schafe in „Silv
- Seite 655 und 656:
Kommentar: 330 Der Handlungsverlauf
- Seite 657 und 658:
332 Mr. Garrideb aus dem Hause lock
- Seite 659 und 660:
2. Tabelle setting/Handlungselement
- Seite 661 und 662:
3. Handlungsverlauf 336 1. Einleitu
- Seite 663 und 664:
338 The Case-Book of Sherlock Holme
- Seite 665 und 666:
340 für das Verbrechen gewesen sin
- Seite 667 und 668:
3. Handlungsverlauf 342 1. Einleitu
- Seite 669 und 670:
344 The Case-Book of Sherlock Holme
- Seite 671 und 672:
Kommentar: 346 Der junge Assistent
- Seite 673 und 674:
348 aber wohl nicht in der Absicht
- Seite 675 und 676:
Kommentar: 350 Der Handlungsverlauf
- Seite 677 und 678:
1. Tabelle Figuren 352 männlich we
- Seite 679 und 680:
354 Variationsgrad setting/Handlung
- Seite 681 und 682:
Kommentar: 356 Der Handlungsverlauf
- Seite 683 und 684:
358 helfen, floh. Er kehrte erst ku
- Seite 685 und 686:
360 Mit der Figur Griggs wird die b
- Seite 687 und 688:
3. Handlungsverlauf 362 1. Einleitu
- Seite 689 und 690:
364 The Case-Book of Sherlock Holme
- Seite 691 und 692:
Kommentar: 366 Mr. Mason stellt ein
- Seite 693 und 694:
3. Handlungsverlauf 368 1. Einleitu
- Seite 695 und 696:
370 The Case-Book of Sherlock Holme
- Seite 697 und 698:
Kommentar: 372 Die Erzählung beste
- Seite 699 und 700:
3. Handlungsverlauf 374 1. Einleitu
- Seite 701 und 702:
376 Agatha Christie: „The Bloodst
- Seite 703 und 704:
Variationsgrad Figuren: 378 _______
- Seite 705 und 706:
380 ‘I, too, think you are just a
- Seite 707 und 708:
382 Agatha Christie: „The Incredi
- Seite 709 und 710:
384 Variationsgrad Figuren: _______
- Seite 711 und 712:
Kommentar: 386 Auch in Bezug auf di
- Seite 713 und 714:
388 Erzähltechnik/discourse: Varia
- Seite 715 und 716:
390 erschwindelt, der aus Zuneigung
- Seite 717 und 718:
392 Die slowakischen Gräfinnen wer
- Seite 719 und 720:
3. Handlungsverlauf 394 1. Harold W
- Seite 721 und 722:
396 Agatha Christie: „The Cretan
- Seite 723 und 724:
398 sterben (wobei Lady Chandler sc
- Seite 725 und 726:
400 finden (z.B. in „Devil’s Fo
- Seite 727 und 728:
402 Agatha Christie: „Tape-Measur
- Seite 729 und 730:
404 hinterlassen könnte. Die Täte
- Seite 731:
Variationsgrad Handlungsverlauf: 40