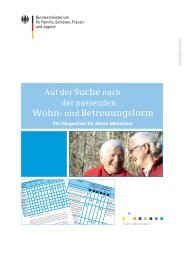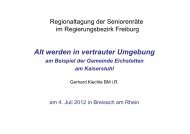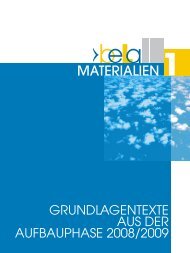- Seite 1 und 2:
Sechster Bericht zur Lage der älte
- Seite 3 und 4:
onen) Gerhard Wegner und Andreas Kr
- Seite 5 und 6:
Prof. Dr. Rudolf Tippelt Ludwig-Max
- Seite 7 und 8:
Die Verfasser und Verfasserinnen vo
- Seite 9 und 10:
Veranstaltungen der Sechsten Altenb
- Seite 11 und 12:
Inhaltsverzeichnis Vorwort ........
- Seite 13 und 14:
6 Arbeitswelt und Personalstrategie
- Seite 15 und 16:
9.3.5 Zugang und Inanspruchnahme: D
- Seite 17 und 18:
14.1.1 Bilder über andere - Bilder
- Seite 19 und 20:
Abbildung 14.5: Vergleich verschied
- Seite 21 und 22:
Übersichtenverzeichnis Übersicht
- Seite 23 und 24:
1.1 Die Bedeutung von Altersbildern
- Seite 25 und 26:
Die Bundesregierung hat die Sachver
- Seite 27 und 28:
Die primäre Zielgruppe eines von d
- Seite 29 und 30:
nis älterer Menschen, tätig zu se
- Seite 31 und 32:
Mit Blick auf die Politik ist festz
- Seite 33 und 34:
trautem und fehlende Offenheit für
- Seite 35 und 36:
Bezogenheit auf andere definiert, e
- Seite 37 und 38:
und von den Generationenbeziehungen
- Seite 39 und 40:
Kategorie zugeordnet. Dieser Prozes
- Seite 41 und 42:
anderes unter „Altersbildern“ v
- Seite 43 und 44:
schaftlichen Disziplinen, die Alter
- Seite 45 und 46:
Beziehungen zwischen Jung und Alt u
- Seite 47 und 48:
demografischen Wandels zusammengetr
- Seite 49 und 50:
der seit 1993 erscheinenden Altenbe
- Seite 51 und 52:
weil die Unvollständigkeit ihrer P
- Seite 53 und 54:
Die Wissenschaft nimmt also durchau
- Seite 55 und 56:
dass die Heraufsetzung des Rentenal
- Seite 57 und 58:
Übersicht 2.4: Die Erfassung von A
- Seite 59 und 60:
als Männer - sie werden demnach al
- Seite 61 und 62:
2.8 Wie wirken Altersbilder? Auch i
- Seite 63 und 64: allgemeinern sie und richten in all
- Seite 65 und 66: älterer Menschen an der Gesamtbev
- Seite 67 und 68: jektive Wahrnehmung und Einschätzu
- Seite 69 und 70: 3.1 Historische Perspektiven auf Al
- Seite 71 und 72: sprechend unvorteilhaften Altersbil
- Seite 73 und 74: ihre weite Verbreitung sorgten. Im
- Seite 75 und 76: sichten vom Alter. Alterszeichen wu
- Seite 77 und 78: Spätestens in der zweiten Hälfte
- Seite 79 und 80: auswiesen. Für die Älteren war es
- Seite 81 und 82: (Penkert 1998). Zur Mitte des Jahrz
- Seite 83 und 84: Schwerindustrie und in anderen Bran
- Seite 85 und 86: jünger werden. Folglich nahm auch
- Seite 87 und 88: kulturelle Wandel- und Gestaltbarke
- Seite 89 und 90: sein können, dass sie nicht als al
- Seite 91 und 92: den (Entlastungsfunktion). Altersbi
- Seite 93 und 94: gegenwärtigen, stehen Altersbilder
- Seite 95 und 96: situation befinden sich in unserer
- Seite 97 und 98: Aus diesen religiösen Grundsätzen
- Seite 99 und 100: nen in dem Maße steigt, wie sie ku
- Seite 101 und 102: Und da sich die Vielfalt der Mögli
- Seite 103 und 104: gewürdigt worden ist (Westerholt 2
- Seite 105 und 106: Popularität von Alters-Ratgebern v
- Seite 107 und 108: tungen ebenso wie plural wuchernde
- Seite 109 und 110: schen oder gesundheitspolitischen B
- Seite 111 und 112: grund körperlicher und geistiger K
- Seite 113: 4 Altersbilder und Rollenmodelle de
- Seite 117 und 118: Für die Diskussion um Altersbilder
- Seite 119 und 120: Älteren selbst vonstatten geht. Ge
- Seite 121 und 122: und Reproduktion/Innovation) ergebe
- Seite 123 und 124: kann dann persönlichkeitsorientier
- Seite 125 und 126: orientierten Kriterien nicht auf di
- Seite 127 und 128: Sterben nicht aus dem Leben ausgegr
- Seite 129 und 130: tenverfügungen wird flankiert von
- Seite 131 und 132: • Bürgerschaftliches Engagement
- Seite 133 und 134: gesunken sind. Insgesamt stagnieren
- Seite 135 und 136: Tabelle 4.1: Engagementquoten aus v
- Seite 137 und 138: produktiven Alterns in Europa“ im
- Seite 139 und 140: gestaltet sein, dass sich Grenzen z
- Seite 141 und 142: dieser Begegnungen, des Austauschs
- Seite 143 und 144: 5 Altersbilder in Bildung und Weite
- Seite 145 und 146: Bildung mehr oder weniger beiläufi
- Seite 147 und 148: lernenden Person beschränken, sie
- Seite 149 und 150: Utilitaristen nehmen an Weiterbildu
- Seite 151 und 152: Während Menschen von einer in frü
- Seite 153 und 154: schaftliche Integration und Innovat
- Seite 155 und 156: len lässt. Erwerbsunfähigkeit und
- Seite 157 und 158: che Einflüsse gewinnen in einer Ze
- Seite 159 und 160: ationen sind wichtig. Leider liegen
- Seite 161 und 162: 5.5 Berufliche und außerberufliche
- Seite 163 und 164: Migrationshintergrund und Berufssta
- Seite 165 und 166:
Dieser Befund spricht für altersge
- Seite 167 und 168:
6 Arbeitswelt und Personalstrategie
- Seite 169 und 170:
etwa ab dem 50. Lebensjahr als „
- Seite 171 und 172:
Frühjahr 2009 zu verzeichnende sch
- Seite 173 und 174:
Tabelle 6.3: Arbeitsmarktbeteiligun
- Seite 175 und 176:
zeitige Rente eine vorrangige Leist
- Seite 177 und 178:
Abbildung 6.1: Struktureller Fachkr
- Seite 179 und 180:
jahren in Altersrente. Dies sind Ja
- Seite 181 und 182:
• die Einführung der flexiblen A
- Seite 183 und 184:
insbesondere das Vorruhestandsgeset
- Seite 185 und 186:
ungeachtet kann sich der Leitgedank
- Seite 187 und 188:
Vorliegende gerontologische sowie a
- Seite 189 und 190:
schen „Erkrankungsrisiko“ vergl
- Seite 191 und 192:
• die Bedeutungszunahme von psych
- Seite 193 und 194:
dass sie weniger motiviert sind. Da
- Seite 195 und 196:
ausüben zu können (Naegele u. a.
- Seite 197 und 198:
drucksvoller Beleg. Vor dieser Kuli
- Seite 199 und 200:
(3) Schließlich wurde das Institut
- Seite 201 und 202:
gänge in die Altersphase erschwert
- Seite 203 und 204:
Abbildung 6.2: Zuschreibung von Eig
- Seite 205 und 206:
den-Württembergs durchgeführt (Ba
- Seite 207 und 208:
Älteren beschäftigen, knapp darü
- Seite 209 und 210:
Vordergrund, die den Austausch von
- Seite 211 und 212:
Zustimmungsquoten bei den Altersste
- Seite 213 und 214:
Übersicht 6.2: Zusammenfassende Da
- Seite 215 und 216:
6.4 Die Rolle der Sozialpartner fü
- Seite 217 und 218:
längerten Arbeitslosengeldbezugs f
- Seite 219 und 220:
Stahlbranche lediglich darum, Perso
- Seite 221 und 222:
eziehungsweise -arbeitnehmerin zur
- Seite 223 und 224:
• Neben der Schrumpfung bildet di
- Seite 225 und 226:
einen Bereich gibt, wo Alter(n)sbil
- Seite 227 und 228:
und b). Zwar wird ein solchermaßen
- Seite 229 und 230:
deutlich, weil die im Fokus stehen
- Seite 231 und 232:
7 Altersbilder und Konsumverhalten
- Seite 233 und 234:
eine ungenaue Einschätzung dafür,
- Seite 235 und 236:
Auch wenn dem Messkonzept des „ko
- Seite 237 und 238:
es führt dazu, dass die Kontextrei
- Seite 239 und 240:
jungen Rezipienten und Rezipientinn
- Seite 241 und 242:
Übersicht 7.2: Alters- und Kohorte
- Seite 243 und 244:
Diese wohlwollend gemeinten Ratschl
- Seite 245 und 246:
nem Produkt oder einer Dienstleistu
- Seite 247 und 248:
Abbildung 7.1: Dove proage Kampagne
- Seite 249 und 250:
Übersicht 7.3: Darstellungen älte
- Seite 251 und 252:
Beispiel in beschützender Bevormun
- Seite 253 und 254:
7.4 Die Analyse von ausgewählten A
- Seite 255 und 256:
Institut für Konsum- und Verhalten
- Seite 257 und 258:
(sofern sie bedienungsfreundlich si
- Seite 259 und 260:
lebnisse können das eigene Älterw
- Seite 261 und 262:
Übersicht 7.5: Phasen der Bewälti
- Seite 263 und 264:
8 Altersbilder und Medien Medien pr
- Seite 265 und 266:
Bei der Agenda-Setting-Hypothese wi
- Seite 267 und 268:
Für eine genauere Analyse medialer
- Seite 269 und 270:
schlechterunterschied nachweisen. F
- Seite 271 und 272:
Abwertende Ausdrücke werden selten
- Seite 273 und 274:
Außerdem wurden in den Jahren 2004
- Seite 275 und 276:
Tabelle 8.1: Nutzungsdauer und Medi
- Seite 277 und 278:
Abbildung 8.3: Entwicklung der Inte
- Seite 279 und 280:
Dieser Gratifikationsansatz geht da
- Seite 281 und 282:
• Weil viele ältere Menschen nur
- Seite 283 und 284:
Unsicherheit bei der Selbsteinschä
- Seite 285 und 286:
1996). In Bezug auf eine passende B
- Seite 287 und 288:
tersbilder jedoch die Art und Weise
- Seite 289 und 290:
8.6.3 Folgen von negativen Altersbi
- Seite 291 und 292:
und Printmedien, Neue Medien und da
- Seite 293 und 294:
den, eine Servicegebühr für die F
- Seite 295 und 296:
einer Person, ihrer gesundheitliche
- Seite 297 und 298:
schen, die steigende Zahl älterer
- Seite 299 und 300:
9.1.3 Verankerung und Umsetzung von
- Seite 301 und 302:
(6) lebensweltbezogene Versorgung u
- Seite 303 und 304:
Alter: Isolation, Einsamkeit und Au
- Seite 305 und 306:
tet. Damit werden die Bedürfnisse
- Seite 307 und 308:
Potenziale und um Möglichkeiten ih
- Seite 309 und 310:
allem als Negation, die aus einem V
- Seite 311 und 312:
Schwierigkeit, diese Zeichen richti
- Seite 313 und 314:
jeweiligen Landeskonzept und seiner
- Seite 315 und 316:
(FDA) von 1993 beide Geschlechter i
- Seite 317 und 318:
(Jung 1976) betonte, dass das Alter
- Seite 319 und 320:
onsmöglichkeiten bei psychischer E
- Seite 321 und 322:
„Altersdepression“ wird der Ein
- Seite 323 und 324:
Pflegerische Leistungen, Unterkunft
- Seite 325 und 326:
grenzung gesundheitsbezogener Leist
- Seite 327 und 328:
Übersicht 9.1: Formen der Rationie
- Seite 329 und 330:
die zum Therapieverzicht verweist W
- Seite 331 und 332:
Eine Sonderform stellt hierbei die
- Seite 333 und 334:
einer 2002 gegründeten Arbeitsgrup
- Seite 335 und 336:
der Leistungserbringung. Prinzipiel
- Seite 337 und 338:
Reha-Bedarf führt. Aufwändige Ver
- Seite 339 und 340:
sorgung weit über das Medizinische
- Seite 341 und 342:
tive Versorgungsmöglichkeiten - di
- Seite 343 und 344:
9.4.4 Qualifizierung Als Schlüssel
- Seite 345 und 346:
10 Altersbilder und Pflege Mit Pfle
- Seite 347 und 348:
menhang mit der Pflege älterer Men
- Seite 349 und 350:
cherungsgeschehen in Heimen und Pfl
- Seite 351 und 352:
um körperliche Verrichtungen sonde
- Seite 353 und 354:
) sie all das tut und tun kann, was
- Seite 355 und 356:
Erweiterung des herkömmlichen Pfle
- Seite 357 und 358:
Feld der Pflege: Sie prägt das öf
- Seite 359 und 360:
Rahmen eines „Hilfemixes“ statt
- Seite 361 und 362:
hörigen. Dieser Bereich der „Pfl
- Seite 363 und 364:
mehr vom „Heim“ die Rede ist. Z
- Seite 365 und 366:
Leistungsgeschehen der Pflegeversic
- Seite 367 und 368:
Lebensphase Alter erlaubt“ (Remme
- Seite 369 und 370:
der pflegebedürftigen Person deutl
- Seite 371 und 372:
zung konzentrieren sich auf die soz
- Seite 373 und 374:
11 Altersgrenzen im Recht und Alter
- Seite 375 und 376:
grenze in doppelter Hinsicht: leist
- Seite 377 und 378:
Im Bereich des Straßenverkehrs ken
- Seite 379 und 380:
Verdienstsicherungen nach dem Senio
- Seite 381 und 382:
Übersicht 11.4: Tarifliche Regeln
- Seite 383 und 384:
Übersicht 11.5: Altersgrenzen für
- Seite 385 und 386:
grenzen hinsichtlich der Ausübung
- Seite 387 und 388:
11.2.4 Finanzprodukte und Altersgre
- Seite 389 und 390:
kennen bei einigen Versicherungsunt
- Seite 391 und 392:
Krüger 2002). Insofern wäre es be
- Seite 393 und 394:
ge Inanspruchnahme der Altersrente
- Seite 395 und 396:
wird durch das Recht und die Rechts
- Seite 397 und 398:
gen einen vergleichsweise großen S
- Seite 399 und 400:
Zusätzlich wird ein einkommensunab
- Seite 401 und 402:
11.3.4 „Altenwohl“ Landesgesetz
- Seite 403 und 404:
• Information über seniorenrelev
- Seite 405 und 406:
ezogen auf ehrenamtliche Betätigun
- Seite 407 und 408:
Das deutsche Recht kennt an verschi
- Seite 409 und 410:
12 Altersbilder in christlichen Kir
- Seite 411 und 412:
samt. Bemerkenswert ist, dass dabei
- Seite 413 und 414:
dass diese Angewiesenheit nicht daz
- Seite 415 und 416:
talten und die Integrität der Exis
- Seite 417 und 418:
eurteilen darf. In Gottes Ewigkeit
- Seite 419 und 420:
fragmentarisch bleibendes Leben ist
- Seite 421 und 422:
schen Religiosität und Formen der
- Seite 423 und 424:
Es wird deutlich, dass Religiositä
- Seite 425 und 426:
nisieren. Für sie sei die Kirche d
- Seite 427 und 428:
wortlich und so weit wie möglich s
- Seite 429 und 430:
13 Altersbilder in der Politik Alte
- Seite 431 und 432:
lichen Ereignissen und Entwicklunge
- Seite 433 und 434:
Die Abgeordneten des Deutschen Bund
- Seite 435 und 436:
aus der Praxis, dass nicht nur die
- Seite 437 und 438:
[…] Wir wollen dem älteren Mensc
- Seite 439 und 440:
zuletzt von Minderheiten in dieser
- Seite 441 und 442:
sondern Solidarität bedeutet auch
- Seite 443 und 444:
hatten. Damals hatte der Abgeordnet
- Seite 445 und 446:
hinsichtlich ihrer Möglichkeiten u
- Seite 447 und 448:
möglich sein, den demografischen W
- Seite 449 und 450:
ökonomischen Austauschbeziehungen
- Seite 451 und 452:
Konsumgütern und Dienstleistungen
- Seite 453 und 454:
Mitgliedschaft zudem häufiger erst
- Seite 455 und 456:
Die „Seniorenpolitischen Eckpunkt
- Seite 457 und 458:
gen auch die Renten; sinken die Lö
- Seite 459 und 460:
mografisch bedingten Arbeitskräfte
- Seite 461 und 462:
Euro auf bis zu 79 Mrd. Euro erhöh
- Seite 463 und 464:
und für zukünftig vermutlich anst
- Seite 465 und 466:
gen zu sichern, die eine optimale A
- Seite 467 und 468:
Leistungen werden zunehmen. Unter d
- Seite 469 und 470:
schem Wandel im öffentlichen Raum
- Seite 471 und 472:
schrieben), emotionale Elemente (z.
- Seite 473 und 474:
these ist die Annahme, dass Mensche
- Seite 475 und 476:
gefragt, wie gesund sich die Person
- Seite 477 und 478:
der Aufgabe) geschuldet sei (Kemper
- Seite 479 und 480:
14.3 Individuelle Altersbilder in K
- Seite 481 und 482:
Faktor betrifft die Frage, ob Kinde
- Seite 483 und 484:
Abbildung 14.1: Aussagen junger Men
- Seite 485 und 486:
den Ruhestand 39 Prozent, Großelte
- Seite 487 und 488:
ereits für Ältere mehrfach belegt
- Seite 489 und 490:
steigendem Alter die verbleibende L
- Seite 491 und 492:
Abbildung 14.6: Vergleich von drei
- Seite 493 und 494:
Alters-Fremdbilder und nicht auf Al
- Seite 495 und 496:
14.4.4 Altersbilder im sozialen Wan
- Seite 497 und 498:
Abbildung 14.9: Sozialer Wandel in
- Seite 499 und 500:
15 Potenziale und Grenzen des Alter
- Seite 501 und 502:
Bemühen um die Rekonstruktion indi
- Seite 503 und 504:
ständig ist. Diese Aufgabe ergibt
- Seite 505 und 506:
alter definiert wird. Die im Vergle
- Seite 507 und 508:
tation mit Grenzen beinhaltet dabei
- Seite 509 und 510:
Teilhabe und die im sozialen Umfeld
- Seite 511 und 512:
che oder unvollständige Berufskarr
- Seite 513 und 514:
ität, die eine bedeutende Grundlag
- Seite 515 und 516:
1. Den demografischen Wandel als Ge
- Seite 517 und 518:
Soziale Teilhabe und die individuel
- Seite 519 und 520:
Der Begriff „Pflegefall“ birgt
- Seite 521 und 522:
Literaturverzeichnis Adamy, W. (200
- Seite 523 und 524:
Barz, H. und Tippelt, R. (Hrsg.) (2
- Seite 525 und 526:
Brockmann, H. (2002): Why is less m
- Seite 527 und 528:
Callahan, D. (1987): Setting limits
- Seite 529 und 530:
Ehmer, J. (1990): Sozialgeschichte
- Seite 531 und 532:
Gehlen, A. (1956): Urmensch und Sp
- Seite 533 und 534:
Healey, M. K. und Hasher, L. (2009)
- Seite 535 und 536:
Igl, G. (2009b): Zur Strukturierung
- Seite 537 und 538:
Klie, T. und Scholz-Weinrich, G. (1
- Seite 539 und 540:
Kruse, A. (2005b): Störungen im Al
- Seite 541 und 542:
Levy, B., Hausdorff, J. M., Hencke,
- Seite 543 und 544:
Naegele, G. (2008): Politische und
- Seite 545 und 546:
Prahl, H.-W. und Schroeter, K. R. (
- Seite 547 und 548:
Ryan, E. B. Giles, H. Bartolucci, G
- Seite 549 und 550:
Schüller, H. (1995): Die Alterslü
- Seite 551 und 552:
Tippelt, R. und Schmidt, B. (Hrsg.)
- Seite 553:
World Health Organization (WHO) (20