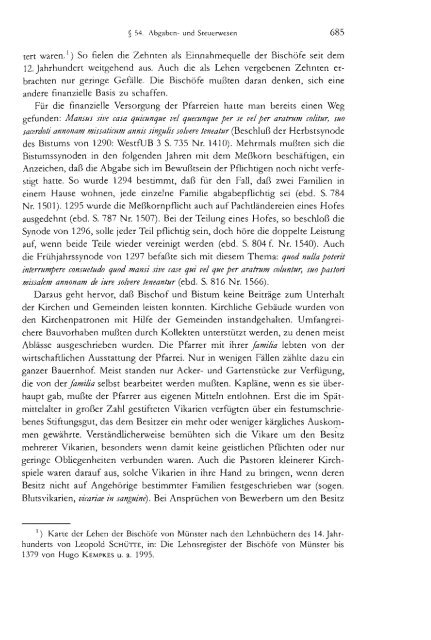- Seite 1 und 2:
GERMANIA SACRA HISTORISCH-STATISTIS
- Seite 3:
@) Gedruckt auf säurefreiem Papier
- Seite 6 und 7:
VI Vorwort wegweisende Anstöße ve
- Seite 8 und 9:
VIII Vorwort wahr, der ebenfalls we
- Seite 11 und 12:
Vorwort .... Abkürzungen . 1. Quel
- Seite 13 und 14:
Inhaltsverzeichnis XIII § 34. Deka
- Seite 15 und 16:
ABKÜRZUNGEN UND SIGLEN Periodica w
- Seite 17 und 18:
Handbuch HansGV HdbHistStätt HdbOs
- Seite 19 und 20:
RepGerm Rh einLebensb Rhei n Wes tf
- Seite 21 und 22:
1. QUELLEN, LITERATUR, DENKMÄLER
- Seite 23 und 24:
§ 1. Quellen 3 Die heute im Bistum
- Seite 25 und 26:
§ 1. Quellen 5 Inventar des Bisch
- Seite 27 und 28:
§ 1. Quellen 7 Richtering Helmut s
- Seite 29 und 30:
§ 2. Literatur 9 Bauermann Johanne
- Seite 31 und 32:
§ 2. Literatur 11 Gams Pius Bonifa
- Seite 33 und 34:
§ 2. Literatur 13 I se rlo h E rwi
- Seite 35 und 36:
§ 2. Literatur Mussinghoff Heinz s
- Seite 37 und 38:
§ 2. Literatur 17 Die Rechtsfriede
- Seite 39 und 40:
§ 3. Denkmäler 19 zu anderen für
- Seite 41 und 42:
§ 3. Denkmäler Der Fürstenhof ne
- Seite 43 und 44:
§ 3. Denkmäler 23 Die Beschaffung
- Seite 45 und 46:
§ 3. Denkmäler 25 Das fürstliche
- Seite 47 und 48:
§ 3. Denkmäler 27 anderem auch au
- Seite 51 und 52:
§ 3. D enkmäler 31 Rechede Die Ba
- Seite 53 und 54:
§ 3. D enkmäler 33 von Oldenburg
- Seite 55 und 56:
§ 3. Denkmäler 35 tete. Bischof L
- Seite 57:
§ 3. Denkmäler 37 Hälfte der Bur
- Seite 60 und 61:
40 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 62 und 63:
42 1. Quellen, Literatur, D enkmäl
- Seite 64 und 65:
44 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 66 und 67:
2. ARCHIVE UND BIBLIOTHEKEN § 4. A
- Seite 68 und 69:
48 2. Archive und Bibliotheken Jahr
- Seite 70 und 71:
50 2. Archive und Bibliotheken des
- Seite 72 und 73:
52 2. Archive und Bibliotheken eine
- Seite 74 und 75:
54 3. Historische Übersicht Sc h m
- Seite 76 und 77:
56 3. Historische Übersicht Friesl
- Seite 78 und 79:
58 3. Historische Übersicht Alkuin
- Seite 80 und 81:
60 3. Historische Übersicht b. Liu
- Seite 82 und 83:
62 3. Historische Übersicht Versuc
- Seite 84 und 85:
64 3. Historische Übersicht c. Gr
- Seite 86 und 87:
66 3. Historische Übersicht unbesi
- Seite 88 und 89:
68 3. Historische Übersicht Auch d
- Seite 90:
70 3. Historische Übersicht an die
- Seite 93 und 94:
§ 7. G eschichte der Diözese von
- Seite 95 und 96:
§ 7. G eschichte der Diözese von
- Seite 97 und 98:
§ 7. Geschichte der Diözese von d
- Seite 99 und 100:
§ 7. Geschichte der Diözese von d
- Seite 101 und 102:
§ 7. Geschichte der Diözese von d
- Seite 103 und 104:
§ 7. G eschjchte der Diözese von
- Seite 105 und 106:
§ 8. Die Diözese unter den letzte
- Seite 107 und 108:
§ 8. Die Diözese unter den letzte
- Seite 109 und 110:
§ 8. Die Diözese unter den letzte
- Seite 111:
§ 8. Die Diözese unter den letzte
- Seite 114 und 115:
94 3. Historische Übersicht Bischo
- Seite 116 und 117:
96 3. Historische Übersicht ben We
- Seite 118 und 119:
98 3. Historische Übersicht wegen
- Seite 120:
100 3. Historische Übersicht Dem B
- Seite 123 und 124:
§ 8. Die Diözese unter den letzte
- Seite 125 und 126:
§ 9. Von der Diözese zum Fürstbi
- Seite 127 und 128:
§ 9. Von der Diözese zum Fürstbi
- Seite 129 und 130:
§ 9. Von der Diözese zum Fürstbi
- Seite 131 und 132:
§ 9. Von der Diözese zum Fürstbi
- Seite 133 und 134:
§ 9. Von der Diözese zum Fürstbi
- Seite 135 und 136:
§ 9. Von der Diözese zum Fürstbi
- Seite 137 und 138:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 139 und 140:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 141 und 142:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 143 und 144:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 145 und 146:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 147 und 148:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 149 und 150:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 151 und 152:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 153 und 154:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 155 und 156:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 157 und 158:
§ 10. Die Diözese unter den erste
- Seite 159 und 160:
§ 11 . Die E ntmachtung der Fürst
- Seite 161 und 162:
§ 11 . Die E ntmachtung der Fürst
- Seite 163 und 164:
§ 11 . Die E ntmachtung der Fürst
- Seite 165 und 166:
§ 11 . Die Entmachtung der Fürstb
- Seite 167 und 168:
§ 11. Die E ntmachtung der Fürstb
- Seite 169 und 170:
§ 11 . Die Entmachtung der Fürstb
- Seite 171 und 172:
§ 11. Die E ntmachtung der Fürstb
- Seite 173 und 174:
§ 11 . Die E ntmachtung der Fürst
- Seite 175 und 176:
§ 11. Die E ntmachtung der Fürstb
- Seite 177 und 178:
§ 11 . Die E ntmachtung der Fürst
- Seite 179 und 180:
§ 11. Die Entmachtung der Fürstbi
- Seite 181:
§ 11 . Die E ntmachtung der Fürst
- Seite 184 und 185:
164 3. Historische Übersicht Nach
- Seite 186 und 187:
166 3. Historische Übersicht Schö
- Seite 188 und 189:
168 3. Hjstorjsche Übersjcht von H
- Seite 190 und 191:
170 3. Historische Übersicht Müns
- Seite 192 und 193:
172 3. Historische Übersicht Bisch
- Seite 194 und 195:
174 3. Historische Übersicht In de
- Seite 196 und 197:
176 3. Historische Übersicht Erzbi
- Seite 198 und 199:
178 3. Historische Übersicht dem K
- Seite 200 und 201:
180 3. Historische Übersicht Die f
- Seite 202 und 203:
182 3. Historische Übersicht sich
- Seite 204 und 205:
184 3. Historische Übersicht 1. Er
- Seite 206 und 207:
186 3. Historische Übersicht here
- Seite 208 und 209:
188 3. Historische Übersicht Nun e
- Seite 210 und 211:
190 3. Historische Übersicht Beitr
- Seite 212 und 213:
192 3. Historische Übersicht Breme
- Seite 214 und 215:
194 3. Historische Übersicht zusch
- Seite 216 und 217:
196 3. Historische Übersicht auf,
- Seite 218 und 219:
198 3. Historische Übersicht 1486
- Seite 220 und 221:
200 3. Historische Übersicht der a
- Seite 222 und 223:
202 3. Historische Übersicht krieg
- Seite 224 und 225:
204 3. Historische Übersicht schen
- Seite 226 und 227:
206 3. Historische Übersicht fast
- Seite 228 und 229:
208 3. Historische Übersicht v. Bi
- Seite 230 und 231:
210 3. Historische Übersicht Monni
- Seite 233 und 234:
§ 14. Das Ringen um die Macht 213
- Seite 235 und 236:
§ 14. D as Ri ngen um die Macht 21
- Seite 237 und 238:
§ 14. Das Ringen um die Macht 217
- Seite 239 und 240:
§ 14. Das Ringen um die Macht 219
- Seite 241 und 242:
§ 14. Das Ringen um die Macht 221
- Seite 243 und 244:
§ 14. Das Ringen um die Macht 223
- Seite 245 und 246:
§ 14. D as Ringen um die Macht 225
- Seite 247 und 248:
§ 14. D as Ringen um die Macht 227
- Seite 250 und 251:
230 3. Historische Übersicht Dem K
- Seite 252 und 253:
232 3. Historische Übersicht aller
- Seite 254 und 255:
234 3. Historische Übersicht Der S
- Seite 256 und 257:
236 3. Historische Übersicht Grego
- Seite 258 und 259:
238 3. Historische Übersicht gifä
- Seite 260 und 261:
240 3. Historische Übersicht Da br
- Seite 262 und 263:
242 3. Historische Übersicht nigte
- Seite 264 und 265:
244 3. Historische Übersicht den T
- Seite 266 und 267:
246 3. Historische Übersicht achte
- Seite 268 und 269:
248 3. Historische Übersicht neben
- Seite 270 und 271:
250 3. Historische Übersicht hof v
- Seite 272 und 273:
252 3, Historische Übersicht stift
- Seite 275 und 276:
§ 15. Zeitalter der Konfessionalis
- Seite 277 und 278:
§ 15. Zeitalter der Konfessionalis
- Seite 279 und 280:
§ 15. Zeitalter der Konfessionalis
- Seite 281 und 282:
§ 15. Zeitalter der Konfessionalis
- Seite 283 und 284:
§ 15. Zeitalter der Konfessionalis
- Seite 285 und 286:
§ 15. Zeitalter der Konfessionalis
- Seite 287 und 288:
§ 16. Endgültige Rekatholisierung
- Seite 289 und 290:
§ 16. Endgültige Rekatholisierung
- Seite 291 und 292:
§ 16. E ndgültige RekathoLsierung
- Seite 293 und 294:
§ 16. E ndgültige Rekatholisierun
- Seite 295 und 296:
§ 17. Das Fürstbistum in der Inte
- Seite 297 und 298:
§ 17. Das Fürstbistum in der lnte
- Seite 299 und 300:
§ 17. Das Fürstbistum in der Inte
- Seite 301 und 302:
§ 17. Das Fürstbistum in der Inte
- Seite 303 und 304:
§ 17. D as Fürstbistum in der Int
- Seite 306 und 307:
286 3. Historische Übersicht Auch
- Seite 308 und 309:
288 3. Historische Übersicht vor s
- Seite 310 und 311:
290 3. Historische Übersicht den K
- Seite 312 und 313:
292 3. Historische Übersicht Feine
- Seite 314 und 315:
294 3. Historische Übersicht chant
- Seite 316 und 317:
296 3. Historische Übersicht Er gl
- Seite 318 und 319:
298 3. Historische Übersicht Neben
- Seite 320 und 321:
300 3. Historische Übersicht und e
- Seite 322 und 323:
302 3. Historische Übersicht bergs
- Seite 324 und 325:
304 3. Historische Übersicht auch
- Seite 326 und 327:
306 3. Historische Übersicht Wiens
- Seite 328 und 329:
308 3. Historische Übersicht Die E
- Seite 330 und 331:
310 3. Historische Übersicht tersc
- Seite 332 und 333:
312 3. Historische Übersicht Freil
- Seite 334 und 335:
314 3. Historische Übersicht Als d
- Seite 336:
316 3. Historische Übersicht Gerad
- Seite 340 und 341:
320 3. Historische Übersicht inkon
- Seite 342 und 343:
322 3. Historische Übersicht von N
- Seite 344 und 345:
324 4. Verfassung sero Seit 1118 wu
- Seite 346 und 347:
326 4. Verfassung einen Verwandten.
- Seite 348 und 349:
328 4. Verfassung S. 50; Kreisel).
- Seite 350 und 351:
330 4. Verfassung Wege stehende Wah
- Seite 352 und 353:
332 4. Verfassung 1612) durch eine
- Seite 354 und 355:
334 4. Verfassung warfen ihm weiter
- Seite 356 und 357:
336 4. Verfassung regionale Bild ge
- Seite 358 und 359:
338 4. Verfassung Vom Papst eingese
- Seite 360:
340 4. Verfassung Schwerer läßt s
- Seite 363 und 364:
§ 23. Bistumskumulatio nen 343 Hei
- Seite 365 und 366:
§ 23. Bistumskumulationen 345 Maxi
- Seite 367 und 368:
§ 24. Koadjutorien 347 eine für s
- Seite 369 und 370:
§ 24. Koadjutorien 349 stenberg al
- Seite 371 und 372:
§ 24. Koadjutori en 351 den, obgle
- Seite 373 und 374:
§ 25. Beziehungen des Bistums zum
- Seite 375 und 376:
§ 25. Beziehungen des Bistums zum
- Seite 377 und 378:
§ 25. Beziehungen des Bistums zum
- Seite 379 und 380:
§ 25. Beziehungen des Bistums zum
- Seite 381 und 382:
§ 25. Beziehungen des Bistums zum
- Seite 383 und 384:
§ 25. Beziehungen des Bistums zum
- Seite 385 und 386:
§ 26. Verhältnis des Bistums zu K
- Seite 387:
§ 26. Verhältnis des Bistums zu K
- Seite 391 und 392:
§ 26. Verhältnis des Bistums zu K
- Seite 393 und 394:
§ 26. Verhältnis des Bistums zu K
- Seite 395 und 396:
§ 26. Verhältnis des Bistums zu K
- Seite 397 und 398:
§ 26. Verhältnis des Bistums zu K
- Seite 400 und 401:
380 4. Verfassung zu Erfurt, wie vo
- Seite 402:
382 4. Verfassung ses zum deutschen
- Seite 405 und 406:
§ 27. Verhältnis des Bistums zum
- Seite 407 und 408:
§ 27. Verhältnis des Bistums zum
- Seite 409 und 410:
§ 27. Verhältnis des Bistums zum
- Seite 411 und 412:
§ 27. Verhältnis des Bistums zum
- Seite 413 und 414:
§ 28. Vogtei 393 Bischof von Müns
- Seite 415 und 416:
§ 28. Vogtei 395 seiner Burg auf d
- Seite 417 und 418:
§ 29. Die Landstände 397 Ganzer K
- Seite 419 und 420:
§ 29. Die Landstände 399 gierungs
- Seite 421 und 422:
§ 29. Die Landstände 401 ten hatt
- Seite 423 und 424:
§ 29. Die Landstände 403 S. 178 f
- Seite 425 und 426:
§ 29. Die Landstände 405 Nach Bee
- Seite 427 und 428:
§ 30. Bischö flich e Juramente un
- Seite 429 und 430:
§ 30. Bischöfliche Juramente und
- Seite 431 und 432:
§ 30. Bischöfliche Juramente und
- Seite 433 und 434:
§ 31. G renzen der Diözese Münst
- Seite 435 und 436:
§ 31. Grenzen der Diözese Münste
- Seite 437 und 438:
§ 31. Grenzen der D iözese Münst
- Seite 440 und 441:
420 4. Verfassung nenkreis: Presbit
- Seite 443 und 444:
§ 32. Archidiako nate und Kirchort
- Seite 445 und 446:
§ 32. Archidiakonate und Kirchorte
- Seite 447 und 448:
§ 32. Archidiakonate und Kirchorte
- Seite 449 und 450:
§ 32. Archidiakonate und Kirchorte
- Seite 451 und 452:
§ 32. Archidiakonate und Kirchorte
- Seite 453 und 454:
§ 32. Archidiakonate und Kirchorte
- Seite 456 und 457:
436 4. Verfassung auf dem Hof Roxel
- Seite 458 und 459:
438 4. Verfassung Burgs teinfurt, K
- Seite 460 und 461:
440 4. Verfassung Billerbeck, Kapel
- Seite 462 und 463:
442 4. Verfassung Werne, Kapelle im
- Seite 464 und 465:
444 4. Verfassung Appelhülsen, 102
- Seite 466 und 467:
446 4. Verfassung § 33. Propsteien
- Seite 468 und 469:
448 4. Verfassung nach den Gewohnhe
- Seite 470 und 471:
450 1394- (1412?) 1441-vor 1450 (14
- Seite 472:
452 4. Verfassung Sebaldeburen (van
- Seite 475 und 476:
§ 33. Propsteien und Kirchorte im
- Seite 477 und 478:
§ 33. Propsteien und Kirchorte im
- Seite 480 und 481:
460 4. Verfassung dedicatione eiusd
- Seite 482:
462 4. Verfassung Spijk (van der Aa
- Seite 485 und 486:
§ 33. Propsteien und Kirchorte im
- Seite 487:
§ 33. Propsteien und Kirchorte im
- Seite 491 und 492:
§ 33. Propsteien und Kirchorte im
- Seite 493 und 494:
§ 33. Propsteien und Kirchorte im
- Seite 495 und 496:
§ 34. D ekanate und Kirchorte im N
- Seite 497 und 498:
§ 34. Dekanate und Kirchorte im Ni
- Seite 499 und 500:
§ 34. Dekanate und Kirchorte im Ni
- Seite 501 und 502:
§ 34. D ekanate und Kirchorte im N
- Seite 503 und 504:
§ 34. D ekanate und Kirchorte im N
- Seite 505 und 506:
§ 35. Stifte und Klöster im O ber
- Seite 507 und 508:
§ 35. Stifte und Klöster im O ber
- Seite 510:
490 4. Verfassung Damenstift St. Ma
- Seite 513 und 514:
§ 35. Stifte und Klöster im Obers
- Seite 515 und 516:
§ 35. Stifte und Klöster im Obers
- Seite 517 und 518:
§ 36. Stifte und Klöster im müns
- Seite 519:
§ 36. Stifte und Klöster im müns
- Seite 523 und 524:
§ 36. Stifte und Klöster im müns
- Seite 526 und 527:
506 4. Verfassung weg S. 35; vom Br
- Seite 529 und 530:
§ 38. D iözesansynoden und Synoda
- Seite 531 und 532:
§ 38. Diäzesansynoden und Synodal
- Seite 533 und 534:
§ 38. Diözesansynoden und Synodal
- Seite 535 und 536:
§ 38. Diözesansynoden und Synodal
- Seite 537 und 538:
§ 38. Diäzesansynoden und Synodal
- Seite 539 und 540:
§ 38. D iözesansynoden und Synoda
- Seite 541 und 542:
§ 38. Diözesansynoden und Synodal
- Seite 543 und 544:
§ 39. Visitationen 523 der Gemeind
- Seite 545 und 546:
§ 39. Visitationen 525 hinaus, den
- Seite 547 und 548:
§ 39. Visitationen 527 tion hatte
- Seite 549 und 550:
§ 40. Bischöflicher Hof 529 setzu
- Seite 551 und 552:
§ 40. Bischöflicher Hof 531 delt.
- Seite 553 und 554:
§ 41 . Geistliche Zentralbehörden
- Seite 555 und 556:
§ 41. Geistliche Zentralbehörden
- Seite 557 und 558:
§ 41 . Geistliche Zentralbehörden
- Seite 559 und 560:
§ 41. Geistliche Zentralbehörden
- Seite 561 und 562:
§ 41. Geistliche Zentralbehörden
- Seite 564 und 565:
544 4. Verfassung d. Geistlicher Ra
- Seite 566 und 567:
546 4. Verfassung men die Stadt Mü
- Seite 568 und 569:
548 1567-1573 1573-1574 1574-1581 1
- Seite 570 und 571:
550 4. Verfassung § 42. Weihbisch
- Seite 572 und 573:
552 4. Verfassung 1529 -1535 Bernha
- Seite 574 und 575:
554 4. Verfassung GS NF 17,1: Kohl,
- Seite 576 und 577:
556 4. Verfassung Ahlen, Albersloh,
- Seite 578 und 579:
558 4. Verfassung Nr. 906). Lüding
- Seite 580 und 581:
560 4. Verfassung berger bischöfli
- Seite 582 und 583:
562 4. Verfassung Bedeutendster Gru
- Seite 584 und 585:
564 4. Verfassung Grafen von Solms-
- Seite 586 und 587:
566 4. Verfassung Die Lage spitzte
- Seite 588 und 589:
568 4. Verfassung pen am 29. März
- Seite 590 und 591:
570 4. Verfassung fügte, daß er g
- Seite 592 und 593:
572 4. Verfassung genannt). Zum Kir
- Seite 594 und 595:
574 4. Verfassung beck und Coesfeld
- Seite 596 und 597:
576 4. Verfassung Es gelang den Bis
- Seite 598:
578 4. Verfassung l. Amt Rheine Das
- Seite 601 und 602:
§ 43. Ausbildung des weltlichen Te
- Seite 603 und 604:
§ 43. Ausbildung des weltlichen Te
- Seite 605 und 606:
§ 43. Ausbildung des weltlichen Te
- Seite 607 und 608:
§ 43. Ausbildung des weltlichen Te
- Seite 609 und 610:
§ 43. Ausbildung des weltlichen Te
- Seite 611 und 612:
§ 44. Kirchspiele und Bauerschafte
- Seite 613 und 614:
§ 44. h.irchspiele und Bauerschaft
- Seite 615 und 616:
§ 44. Kirchspiele und Bauerschafte
- Seite 617 und 618:
§ 45. Kirchspiele und Bauerschafte
- Seite 619 und 620:
§ 45. Kirchspiele und Bauerschafte
- Seite 621 und 622:
§ 46. Lehnswesen 601 Leihgabe zugu
- Seite 623 und 624:
§ 46. Lehnswesen 603 ausländische
- Seite 625 und 626:
§ 47 . Weltliche Zentralbehörden
- Seite 627 und 628:
§ 47 . Weltliche Zentralbehörden
- Seite 629 und 630:
§ 47. Weltliche Zentralbehörden 6
- Seite 632 und 633:
612 4. Verfassung 1759 -1760 Herman
- Seite 634 und 635:
614 4. Verfassung lehrten, darunter
- Seite 636 und 637:
616 4. Verfassung allen anderen vor
- Seite 638 und 639:
618 4. Verfassung Ungeachtet fortsc
- Seite 640:
620 4. Verfassung Eindruck hinterl
- Seite 643 und 644:
§ 49. Gerichtsverfassung 623 Sei b
- Seite 645 und 646:
§ 49. Gerichtsverfassung 625 ren k
- Seite 647 und 648:
§ 49. Gerichtsverfassung 627 deten
- Seite 649 und 650:
§ 49. G erichtsverfassung 629 konn
- Seite 651 und 652:
§ 49. Gerichtsverfassung 631 Geric
- Seite 653 und 654: § 49. Gerichtsverfassung 633 gehal
- Seite 655 und 656: § 49. Gerichtsverfassung 635 der V
- Seite 657 und 658: § 49. Gerichtsverfassung 637 Ringe
- Seite 659 und 660: § 49. G erichtsverfass ung 639 Kir
- Seite 661: § 49. Gerichtsverfassung 641 zurü
- Seite 664 und 665: 644 4. Verfassung h. Exemte geistli
- Seite 666 und 667: 646 4. Verfassung Die Hofkammer bes
- Seite 668 und 669: 648 4. Verfassung Nach dem Vorbild
- Seite 670 und 671: 650 4. Verfassung Bis zum Ende der
- Seite 672 und 673: 652 4. Verfassung Hofes zwischen Gu
- Seite 674 und 675: 654 4. Verfassung niger unter histo
- Seite 677 und 678: § 50. Grundherrlich-bäuerliche Ve
- Seite 679 und 680: § 50. Grundherrlich-bäuerliche Ve
- Seite 681 und 682: § 51. Militärverfassung 661 Zeige
- Seite 683: § 51. Militärverfassung 663 tisch
- Seite 686 und 687: 666 4. Verfassung Damit übernahm d
- Seite 688 und 689: 668 4. Verfassung Hülsmann Heinric
- Seite 690 und 691: 670 4. Verfassung feld, Borken und
- Seite 692 und 693: 672 4. Verfassung Über den schwere
- Seite 694 und 695: 674 4. Verfassung Kr. Ahaus S.43: I
- Seite 696: 676 4. Verfassung Die "Polizei" im
- Seite 699 und 700: § 53. Polizei 679 gen. Schwer zu b
- Seite 701 und 702: § 54. Abgaben- und Steuerwesen 681
- Seite 703: § 54. Abgaben- und Steuerwesen 683
- Seite 707 und 708: § 54. Abgaben- und Steuerwesen 687
- Seite 709 und 710: § 54. Abgaben- und Steuerwesen 689
- Seite 711 und 712: § 54. Abgaben- und Steuerwesen 691
- Seite 714 und 715: 694 4. Verfassung N übelOtto, Das
- Seite 716 und 717: 696 4. Verfassung wenn auch in besc
- Seite 718 und 719: 698 4. Verfassung auf das Land. Im
- Seite 720 und 721: 700 4. Verfassung ten für Handel u
- Seite 722 und 723: 702 4. Verfassung Essigfabrik, übe
- Seite 724 und 725: 704 4. Verfassung Über das Alter d
- Seite 726 und 727: 706 4. Verfassung Bote benutzte den
- Seite 728 und 729: 708 4. Verfassung der höheren Geis
- Seite 730 und 731: 710 4. Verfassung höhere Tributzah
- Seite 732 und 733: 712 4. Verfassung Großherzoglich B
- Seite 734 und 735: 714 4. Verfassung bezog daraus jäh
- Seite 736 und 737: 716 4. Verfassung Die älteste beka
- Seite 738 und 739: 718 4. Verfassung von Gegenstempeln
- Seite 740: 720 4. Verfassung Geisberg Max, Sta
- Seite 743 und 744: § 61. Siegel 723 Symbolen vollzoge
- Seite 745: § 61. Siegel 725 kreuzt, oben die
- Seite 748 und 749: 728 Register Jh. Jahrhundert osö o
- Seite 751 und 752: Albersloh (13 km sö Münster) Kirc
- Seite 753 und 754: Anholt Bredenasle (13 km w Bocholt)
- Seite 755:
- Kapelle B. Mariae immaculatae 440
- Seite 760 und 761:
740 Register Börstel (15 km osö H
- Seite 762 und 763:
742 Register Kurfürstentum 663; Ku
- Seite 764 und 765:
744 Register Buddenturm in Münster
- Seite 766 und 767:
746 Register Decania, Organisation
- Seite 768:
748 Register Vita Communis 19 Statu
- Seite 771 und 772:
Egmont, Maximilian Gf v. Büren 154
- Seite 773 und 774:
- wirtschaft!. Vorbild 18. Jh. 303,
- Seite 776:
756 Register - Kirche St. Pancratü
- Seite 780 und 781:
760 Register - d. Schöne, Kg 1314-
- Seite 783 und 784:
- v. Keppel, klev. Erbmarschall 147
- Seite 785 und 786:
- Kirche St. Martini 428 - Ksp., Fr
- Seite 789 und 790:
- PapiermüWe 698 Heveskes Hevskenz
- Seite 791 und 792:
Neuenkirchen, Rheine, Stockum, Wett
- Seite 793 und 794:
- (5 km nw Hamm) Ksp. 595, 632 - Ki
- Seite 796:
776 Register Huden, Bs. Ksp. Bokelo
- Seite 801 und 802:
- VI., Kg 1711- 1740 296 - VII., Kg
- Seite 803 und 804:
Klein-Dohren, Bs. Ksp. Herzlake 598
- Seite 805 und 806:
Königsberg (Ksp. Haltern) Kap. 433
- Seite 807 und 808:
v. Coten, Ministerialenfam. 12. Jh.
- Seite 809 und 810:
v. Langen, Farn. 431, 564 - Engelbe
- Seite 811 und 812:
- Kap. St. Michaelis 423; s. Sankt-
- Seite 814 und 815:
794 Register Lünten, Bs. Ksp. Vred
- Seite 816 und 817:
796 Register Marienbuch s. Rengerin
- Seite 818 und 819:
798 Register - Ksp., Stadt, Festung
- Seite 820 und 821:
800 v. Moosburg, Kärntner Gff 89 f
- Seite 823 und 824:
- Quartier 1613 589 - Friede 1679 2
- Seite 825 und 826:
Overpelt, Johann Adrian, Scholaster
- Seite 827 und 828:
- Bündnisse mit Münster 137, 152
- Seite 829 und 830:
Mitglied kathol. Bündnis 1685 281
- Seite 831 und 832:
Pius II., Papst 1458-1464 189 - IV,
- Seite 833:
- Stadtrecht 147, 150 - Gogericht 2
- Seite 836 und 837:
816 Register Rorup Rodorpe (9 km s
- Seite 838:
818 Register Konventualen s. Hilbur
- Seite 843 und 844:
Slunckrave s. Christian Kelner Smal
- Seite 845 und 846:
v. Stern berg s. Simon Sterneberg g
- Seite 850 und 851:
830 Register Uppost s. Buitenpost U
- Seite 852:
832 Register - Kirche 564 - Burg u.
- Seite 855:
Westerrodde, Bs. Ksp. Greven 595 -
- Seite 859:
Zons a. Rh. 194 Zülpich, Schlacht
- Seite 862 und 863:
Tafel II Offizialatssiegel Großes