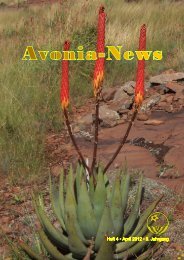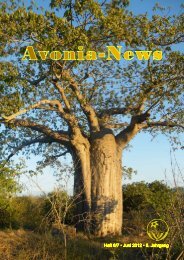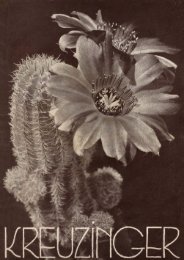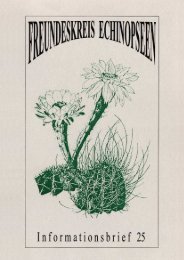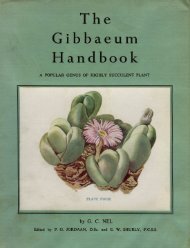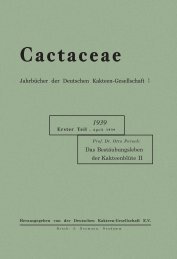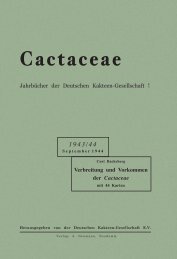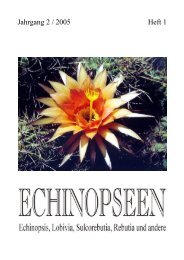- Seite 3 und 4:
D I E C A C T A C E A E Band V
- Seite 5 und 6:
DIE CACTACEAE H A N D B U C H D E R
- Seite 7:
INHALT Beschreibender Teil Cereoide
- Seite 10 und 11:
2632 Echinocactus 177. ECHINOCACTUS
- Seite 12 und 13:
2634 Echinocactus Stacheln (mittler
- Seite 14 und 15:
2636 Echinocactus Abb. 2509. Basal
- Seite 16 und 17:
2638 Echinocactus Britton u. Rose e
- Seite 18 und 19:
2640 Echinocactus Die folgenden, of
- Seite 20 und 21:
2642 Echinocactus Abb. 2517. Blühe
- Seite 22 und 23:
2644 Echinocactus an. Letzterer wur
- Seite 24 und 25:
2646 Echinocactus gelb (?), nicht h
- Seite 26 und 27:
2648 Echinocactus (nach Rost) bis 6
- Seite 28 und 29:
2650 Homalocephala Wolle; Frucht ku
- Seite 30 und 31:
2652 Astrophytum Formentrennung bef
- Seite 32 und 33:
2654 Astrophytum Blüten mittelgro
- Seite 34 und 35:
2656 Astrophytum Abb. 2526. Die obe
- Seite 36 und 37:
2658 Astrophytum Abb. 2528. Astroph
- Seite 38 und 39:
2660 Astrophytum Borg sagt irrig:
- Seite 40 und 41:
2662 Astrophytum 2534 2535 Abb. 253
- Seite 42 und 43:
2664 Astrophytum Die Rippenkanten s
- Seite 44 und 45:
2666 Astrophytum ebensowenig zur Ze
- Seite 46 und 47:
2668 Astrophytum Abb. 2541. Astroph
- Seite 48 und 49:
2670 Astrophytum Meist kugelig, in
- Seite 50 und 51:
2672 Astrophytum gesammelt worden;
- Seite 52 und 53:
2674 Sclerocactus A. capricorne cra
- Seite 54 und 55:
2676 Sclerocactus Mittelstacheln zu
- Seite 56 und 57:
2678 Sclerocactus lich, ± 4kantig,
- Seite 58 und 59:
2680 Sclerocactus Wand, dann auftro
- Seite 60 und 61:
2682 Sclerocactus Abb. 2555. Import
- Seite 62 und 63:
2684 Neogomesia sie öffnet basal;
- Seite 64 und 65:
2686 Neogomesia Abb. 2558. Neogomes
- Seite 66 und 67:
2688 Ferocactus Abb. 2561. Eine Neo
- Seite 68 und 69:
2690 Ferocactus F. echidne und F. v
- Seite 70 und 71:
2692 Ferocactus Mittelstacheln (ein
- Seite 72 und 73:
2694 Ferocactus aber mäßig breit,
- Seite 74 und 75:
2696 Ferocactus Pflanzen wenig spro
- Seite 76 und 77:
2698 Ferocactus Zur Geschichte des
- Seite 78 und 79:
2700 Ferocactus Abb. 2565. Ferocact
- Seite 80 und 81:
2702 Ferocactus Lindsay sagt, l. c.
- Seite 82 und 83:
2704 Ferocactus Abb. 2569. Scheitel
- Seite 84 und 85:
2706 Ferocactus E. emoryi nichts mi
- Seite 86 und 87:
2708 Ferocactus Einzeln, bis 30 cm
- Seite 88 und 89:
2710 Ferocactus kommen sowie im Geb
- Seite 90 und 91:
2712 Ferocactus Abb. 2575. Ferocact
- Seite 92 und 93:
2714 Ferocactus sind allerdings sch
- Seite 94 und 95:
2716 Ferocactus Abb. 2580. Ferocact
- Seite 96 und 97:
2718 Ferocactus Abb. 2581. Ferocact
- Seite 98 und 99:
Abb. 2583. Blühender Ferocactus la
- Seite 100 und 101:
2722 Ferocactus Sep.; Pet. blaß ka
- Seite 102 und 103:
2724 Ferocactus 18a. v. carmenensis
- Seite 104 und 105:
2726 Ferocactus 22. Ferocactus orcu
- Seite 106 und 107:
2728 Ferocactus 1—2 cm hoch, leic
- Seite 108 und 109:
2730 Ferocactus Eine endgültige Kl
- Seite 110 und 111:
2732 Ferocactus unteren Sep. mit r
- Seite 112 und 113:
2734 Ferocactus Abb. 2597. Ferocact
- Seite 114 und 115:
2736 Ferocactus Abb. 2598. Ferocact
- Seite 116 und 117:
2738 Ferocactus 30. Ferocactus pott
- Seite 118 und 119:
2740 Ferocactus rötlich, ganze Lä
- Seite 120 und 121:
2742 Ferocactus Abb. 2604. Ferocact
- Seite 122 und 123:
2744 Hamatocactus suchungen stehen
- Seite 124 und 125:
2746 Hamatocactus Röhre ähnlich b
- Seite 126 und 127:
2748 Hamatocactus baums zeigt. Die
- Seite 128 und 129:
2750 Hamatocactus Auch diese Art sc
- Seite 130 und 131:
2752 Echinofossulocactus 185. ECHIN
- Seite 132 und 133:
2754 Echinofossulocactus Aus vorerw
- Seite 134 und 135:
2756 Echinofossulocactus Ty p u s :
- Seite 136 und 137:
2758 Echinofossulocactus Blüten we
- Seite 138 und 139:
2760 Echinofossulocactus 5 cm lang,
- Seite 140 und 141:
2762 Echinofossulocactus lang, oben
- Seite 142 und 143:
2764 Echinofossulocactus mehrt, die
- Seite 144 und 145:
2766 Echinofossulocactus färbe sta
- Seite 146 und 147:
2768 Echinofossulocactus 8. Echinof
- Seite 148 und 149:
Scmoll -> Schmoll 2770 Echinofossul
- Seite 150 und 151: 2772 Echinofossulocactus 13. Echino
- Seite 152 und 153: 2774 Echinofossulocactus wellt; Are
- Seite 154 und 155: 2776 Echinofossulocactus kurz gespi
- Seite 156 und 157: 2778 Echinofossulocactus anfangs gr
- Seite 158 und 159: 2780 Echinofossulocactus spitzlich;
- Seite 160 und 161: 2782 Echinofossulocactus Beschreibu
- Seite 162 und 163: 2784 Echinofossulocactus Abb. 2621.
- Seite 164 und 165: 2786 Echinofossulocactus Kugelig bi
- Seite 166 und 167: 2788 Echinofossulocactus Standort n
- Seite 168 und 169: 2790 Echinofossulocactus S. J. (US.
- Seite 170 und 171: 2792 Coloradoa Borg hat die Beschre
- Seite 172 und 173: 2794 Thelocactus Höcker nicht tief
- Seite 174 und 175: 2796 Thelocactus Schlüssel der Art
- Seite 176 und 177: 2798 Thelocactus Rippen gewöhnlich
- Seite 178 und 179: 2800 Thelocactus Die Art ist variab
- Seite 180 und 181: 2802 Thelocactus Abb. 2630. Theloca
- Seite 182 und 183: 2804 Thelocactus Niedergedrückt-ku
- Seite 184 und 185: 2806 Thelocactus Abb. 2637. Theloca
- Seite 186 und 187: 2808 Thelocactus dicht mit bräunli
- Seite 188 und 189: 2810 Thelocactus Abb. 2640. Theloca
- Seite 190 und 191: 2812 Thelocactus Rückenstreifen; P
- Seite 192 und 193: 2814 Thelocactus Abb. 2645. Theloca
- Seite 194 und 195: 2816 Thelocactus schiedenen Formen,
- Seite 196 und 197: 2818 Thelocactus rianth; S. 1,5 mm
- Seite 198 und 199: 2820 Thelocactus Abb. 2652. Theloca
- Seite 202 und 203: 2824 Echinomastus anheftung, erwäh
- Seite 204 und 205: 2826 Echinomastus Mittelstacheln 4,
- Seite 206 und 207: 2828 Echinomastus Abb. 2655. „Ech
- Seite 208 und 209: 2830 Echinomastus Abb. 2657. Echino
- Seite 210 und 211: 2832 Echinomastus Abb. 2659. „Ech
- Seite 212 und 213: 2834 Echinomastus diese seitlich zu
- Seite 214 und 215: 2836 Echinomastus Abb. 2663. Echino
- Seite 216 und 217: 2838 Utahia Blüten-, Frucht- und S
- Seite 218 und 219: 2840 Utahia Vo r k o m m e n : USA
- Seite 220 und 221: 2842 Pediocactus es sich bei den be
- Seite 222 und 223: 2844 Pediocactus Rose) oder nur unt
- Seite 224 und 225: 2846 Pediocactus den Schumann spät
- Seite 226 und 227: 2848 Gymnocactus auf“! Eine Abtre
- Seite 228 und 229: 2850 Gymnocactus Körper mehr breit
- Seite 230 und 231: 2852 Gymnocactus Abb. 2674. Gymnoca
- Seite 232 und 233: 2854 Gymnocactus Abb. 2677. Gymnoca
- Seite 234 und 235: 2856 Gymnocactus ∅ messende Beflo
- Seite 236 und 237: 2858 Gymnocactus Abb. 2681. Gymnoca
- Seite 238 und 239: 2860 Gymnocactus Abb. 2683. Gymnoca
- Seite 240 und 241: 2862 Gymnocactus Abb. 2687. Gymnoca
- Seite 242 und 243: 2864 Gymnocactus Abb. 2690. Gymnoca
- Seite 244 und 245: 2866 Strombocactus 192. STROMBOCACT
- Seite 246 und 247: 2868 Obregonia als Publikationsjahr
- Seite 248 und 249: 2870 Toumeya (s. oben). Die Angaben
- Seite 250 und 251:
2872 Navajoa 195. NAVAJOA Croiz. C.
- Seite 252 und 253:
2874 Navajoa Abb. 2698. Makroaufnah
- Seite 254 und 255:
2876 Pilocanthus 2701 2702 Abb. 270
- Seite 256 und 257:
2878 Pilocanthus Abb. 2705. Pilocan
- Seite 258 und 259:
2880 Pilocanthus cactus, sondern ra
- Seite 260 und 261:
2882 Turbinicarpus Schlüssel der A
- Seite 262 und 263:
2884 Turbinicarpus dunklerer Mittel
- Seite 264 und 265:
2886 Turbinicarpus Abb. 2715. Turbi
- Seite 266 und 267:
2888 Turbinicarpus grünlich-weiße
- Seite 268 und 269:
2890 Aztekium Daraus geht hervor, d
- Seite 270 und 271:
2892 Aztekium Ausreichende Gattungs
- Seite 272 und 273:
2894 Lophophora forderte auch die A
- Seite 274 und 275:
2896 Lophophora 1. Lophophora willi
- Seite 276 und 277:
2898 Lophophora Henn. mss., 1888 vo
- Seite 278 und 279:
2900 Lophophora wieder, weil Croiza
- Seite 280 und 281:
2902 Lophophora weicher, auch gutw
- Seite 282 und 283:
2904 Epithelantha von Weber publizi
- Seite 284 und 285:
2906 Epithelantha Areolen mit deutl
- Seite 286 und 287:
2908 Epithelantha 1. Epithelantha m
- Seite 288 und 289:
2910 Epithelantha Abb. 2738. Epithe
- Seite 290 und 291:
2912 Epithelantha lewinii sensu Cou
- Seite 292 und 293:
2914 Epithelantha brauner Spitze. I
- Seite 294 und 295:
2916 Epithelantha Abb. 2750. Epithe
- Seite 296 und 297:
2918 Mediocoryphanthae 2a. v. elong
- Seite 298 und 299:
2920 Glandulicactus 201. GLANDULICA
- Seite 300 und 301:
2922 Glandulicactus deutlich zeigt.
- Seite 302 und 303:
2924 Glandulicactus areole länglic
- Seite 304 und 305:
2926 Ancistrocactus der Samen- und
- Seite 306 und 307:
2928 Ancistrocactus Abb. 2762. Anci
- Seite 308 und 309:
2930 Ancistrocactus dick, grün, be
- Seite 310 und 311:
2932 Mamillariae seit Britton u. Ro
- Seite 312 und 313:
2934 Neolloydia zu Neolloydia zu st
- Seite 314 und 315:
2936 Neolloydia dickt, abstehend, g
- Seite 316 und 317:
2938 Neolloydia Abb. 2768. Neolloyd
- Seite 318 und 319:
2940 Neolloydia Abb. 2771. Neolloyd
- Seite 320 und 321:
2942 Neobesseya wir annehmen, daß
- Seite 322 und 323:
2944 Neobesseya Sepalen gewimpert B
- Seite 324 und 325:
2946 Neobesseya Abb. 2777. Neobesse
- Seite 326 und 327:
2948 Neobesseya erscheint mir die v
- Seite 328 und 329:
2950 Escobaria rosa Jungstacheln, h
- Seite 330 und 331:
2952 Escobaria besseya dasyacantha
- Seite 332 und 333:
2954 Escobaria Ungenügend bekannt:
- Seite 334 und 335:
2956 Escobaria Abb. 2784. Escobaria
- Seite 336 und 337:
2958 Escobaria 2785 2786 Abb. 2785.
- Seite 338 und 339:
2960 Escobaria Abb. 2789. Eine der
- Seite 340 und 341:
2962 Escobaria Abb. 2793. Escobaria
- Seite 342 und 343:
2964 Escobaria obige Art 1921 in Me
- Seite 344 und 345:
2966 Escobaria Einzeln, dann spross
- Seite 346 und 347:
2968 Escobaria und durch das reiche
- Seite 348 und 349:
2970 Escobaria Abb. 2803. Escobaria
- Seite 350 und 351:
2972 Lepidocoryphantha Pflanze ist
- Seite 352 und 353:
2974 Lepidocoryphantha Abb. 2805. L
- Seite 354 und 355:
2976 Lepidocoryphantha Warzenlänge
- Seite 356 und 357:
2978 Lepidocoryphantha Abb. 2810. L
- Seite 358 und 359:
2980 Coryphantha den beiden letzter
- Seite 360 und 361:
2982 Coryphantha Ohne Glandeln Peri
- Seite 362 und 363:
2984 Coryphantha Reihe 1: Sulcolana
- Seite 364 und 365:
2986 Coryphantha Randstacheln 6—8
- Seite 366 und 367:
2988 Coryphantha Mittelstacheln meh
- Seite 368 und 369:
2990 Coryphantha Reihe 2: Recurvata
- Seite 370 und 371:
2992 Coryphantha [C. kieferiana (ho
- Seite 372 und 373:
2994 Coryphantha 1839. — ? M. sco
- Seite 374 und 375:
2996 Coryphantha Britton u. Rose f
- Seite 376 und 377:
2998 Coryphantha 2b. v. arizonica (
- Seite 378 und 379:
3000 Coryphantha Abb. 2816. Corypha
- Seite 380 und 381:
3002 Coryphantha Nach L. Benson (Th
- Seite 382 und 383:
3004 Coryphantha Abb. 2820. Corypha
- Seite 384 und 385:
3006 Coryphantha Pflanze soll klein
- Seite 386 und 387:
3008 Coryphantha 12. Coryphantha pe
- Seite 388 und 389:
3010 Coryphantha Abb. 2826. Corypha
- Seite 390 und 391:
3012 Coryphantha Coryphantha altami
- Seite 392 und 393:
3014 Coryphantha verwendet, der bei
- Seite 394 und 395:
3016 Coryphantha nach 5er und 8er B
- Seite 396 und 397:
3018 Coryphantha 21. Coryphantha du
- Seite 398 und 399:
3020 Coryphantha Abb. 2837. Corypha
- Seite 400 und 401:
3022 Coryphantha 2839 2840 Abb. 283
- Seite 402 und 403:
3024 Coryphantha Abb. 2843. Corypha
- Seite 404 und 405:
3026 Coryphantha zylindrisch, bis 7
- Seite 406 und 407:
3028 Coryphantha Rasenförmig; Einz
- Seite 408 und 409:
3030 Coryphantha Die Pflanze ähnel
- Seite 410 und 411:
3032 Coryphantha Britton u. Rose sa
- Seite 412 und 413:
3034 Coryphantha Britton u. Rose hi
- Seite 414 und 415:
3036 Coryphantha 7 mm lang, oft fad
- Seite 416 und 417:
3038 Coryphantha Bergers Beschreibu
- Seite 418 und 419:
3040 Coryphantha Abb. 2860. Corypha
- Seite 420 und 421:
3042 Coryphantha 44. Coryphantha oc
- Seite 422 und 423:
3044 Coryphantha hervorgeht.“ Kun
- Seite 424 und 425:
3046 Coryphantha gebogen, weißgrau
- Seite 426 und 427:
3048 Coryphantha hellgelb; N. 7—1
- Seite 428 und 429:
3050 Coryphantha Abb. 2871. Corypha
- Seite 430 und 431:
3052 Coryphantha Ich glaube nicht,
- Seite 432 und 433:
3054 Coryphantha gekerbt-ausgerande
- Seite 434 und 435:
3056 Coryphantha sie soll oben ± g
- Seite 436 und 437:
3058 Coryphantha Abb. 2878. Corypha
- Seite 438 und 439:
3060 Coryphantha überragt; Warzen
- Seite 440 und 441:
3062 Coryphantha Abb. 2883. Corypha
- Seite 442 und 443:
3064 Roseocactus „Schmal-zylindri
- Seite 444 und 445:
3066 Roseocactus Ty p u s : Mamilla
- Seite 446 und 447:
3068 Roseocactus als von Engelmann
- Seite 448 und 449:
3070 Roseocactus schwach wolligen S
- Seite 450 und 451:
3072 Roseocactus 2893 (links) Abb.
- Seite 452 und 453:
3074 Roseocactus 2894 2895 Abb. 289
- Seite 454 und 455:
3076 Encephalocarpus so verlief, wi
- Seite 456 und 457:
3078 Pelecyphora weil er an den win
- Seite 458 und 459:
3080 Pelecyphora jedoch darüber ni
- Seite 460 und 461:
3082 Solisia neuerdings doch wieder
- Seite 462 und 463:
3084 Ariocarpus bilden. Ich kann so
- Seite 464 und 465:
3086 Ariocarpus lineal-spatelig, st
- Seite 466 und 467:
3088 Ariocarpus wiedergegebenen Pfl
- Seite 468 und 469:
3090 Ariocarpus Pflanzen?), bis 4 c
- Seite 470 und 471:
3092 Mamillaria kationen. Viele Geg
- Seite 472 und 473:
3094 Mamillaria Bestimmungsmöglich
- Seite 474 und 475:
3096 Mamillaria Abb. 2912. Die Sch
- Seite 476 und 477:
3098 Mamillaria I. Übersicht über
- Seite 478 und 479:
3100 Mamillaria Reihe 4: Rectospino
- Seite 480 und 481:
3102 Mamillaria Körper mit länger
- Seite 482 und 483:
3104 Mamillaria FF: Pet. grünlichg
- Seite 484 und 485:
3106 Mamillaria LL: W. nach Bz. 8 :
- Seite 486 und 487:
3108 Mamillaria HH: W. rund, wenigs
- Seite 488 und 489:
3110 Mamillaria GG: Pet. weiß . .
- Seite 490 und 491:
3112 Mamillaria I: W. weichfleischi
- Seite 492 und 493:
3114 Mamillaria II: Rst. 16—18; z
- Seite 494 und 495:
3116 Mamillaria Braun: M. elongata
- Seite 496 und 497:
3118 Mamillaria Borg, Cacti, 352. 1
- Seite 498 und 499:
3120 Mamillaria 4. Mamillaria polye
- Seite 500 und 501:
3122 Mamillaria 5. Mamillaria confu
- Seite 502 und 503:
3124 Mamillaria handeln, die in Deu
- Seite 504 und 505:
3126 Mamillaria weicht doch viel st
- Seite 506 und 507:
3128 Mamillaria 9. Mamillaria orteg
- Seite 508 und 509:
3130 Mamillaria Einzeln bis sprosse
- Seite 510 und 511:
3132 Mamillaria Vielleicht ist eine
- Seite 512 und 513:
3134 Mamillaria Von M. recurva (Syn
- Seite 514 und 515:
3136 Mamillaria nii“). — M. fal
- Seite 516 und 517:
3138 Mamillaria Als Synonym erwähn
- Seite 518 und 519:
3140 Mamillaria Die Körpermaße ge
- Seite 520 und 521:
3142 Mamillaria Craig spricht die V
- Seite 522 und 523:
3144 Mamillaria Werdermann sagt l.
- Seite 524 und 525:
3146 Mamillaria später fleischfarb
- Seite 526 und 527:
3148 Mamillaria 24a. v. columnaris
- Seite 528 und 529:
3150 Mamillaria Die Stammform und v
- Seite 530 und 531:
3152 Mamillaria zuletzt grau: Bl. z
- Seite 532 und 533:
3154 Mamillaria 31. Mamillaria myst
- Seite 534 und 535:
3156 Mamillaria unterscheiden sie a
- Seite 536 und 537:
3158 Mamillaria Craig gibt hier den
- Seite 538 und 539:
3160 Mamillaria 34b. v. caput-medus
- Seite 540 und 541:
3162 Mamillaria bei dieser Gruppe e
- Seite 542 und 543:
3164 Mamillaria gerade, steif, glat
- Seite 544 und 545:
3166 Mamillaria Spitze mit dunklere
- Seite 546 und 547:
3168 Mamillaria grubig punktiert.
- Seite 548 und 549:
flavesens -> flavescens 3170 Mamill
- Seite 550 und 551:
3172 Mamillaria purpurner Mittelstr
- Seite 552 und 553:
3174 Mamillaria filzig; Ax. anfangs
- Seite 554 und 555:
3176 Mamillaria zeigt ein so langst
- Seite 556 und 557:
3178 Mamillaria mit schwarzen Spitz
- Seite 558 und 559:
3180 Mamillaria ganz, Spitze stumpf
- Seite 560 und 561:
3182 Mamillaria N. 6, krem, zurück
- Seite 562 und 563:
3184 Mamillaria Danach teile ich di
- Seite 564 und 565:
3186 Mamillaria Rst. (stets?) nach
- Seite 566 und 567:
3188 Mamillaria Craig erhielt die P
- Seite 568 und 569:
3190 Mamillaria Perianthrest; S. he
- Seite 570 und 571:
3192 Mamillaria Abb. 2963. Farbbild
- Seite 572 und 573:
3194 Mamillaria Rst. bis ca. 15 (
- Seite 574 und 575:
3196 Mamillaria Abb. 2965. Mamillar
- Seite 576 und 577:
3198 Mamillaria Abb. 2967. Mamillar
- Seite 578 und 579:
3200 Mamillaria lieh etwas zusammen
- Seite 580 und 581:
3202 Mamillaria 68. Mamillaria giga
- Seite 582 und 583:
3204 Mamillaria 71a. v. rubraflora
- Seite 584 und 585:
3206 Mamillaria Mst. 4, 1,5—2,5 c
- Seite 586 und 587:
3208 Mamillaria Abb. 2975. Mamillar
- Seite 588 und 589:
3210 Mamillaria bräunlichrosa, 0,8
- Seite 590 und 591:
3212 Mamillaria die Art der Axillen
- Seite 592 und 593:
3214 Mamillaria v. hexispina (Schmo
- Seite 594 und 595:
3216 Mamillaria Abb. 2981. Mamillar
- Seite 596 und 597:
3218 Mamillaria wirkten, die also d
- Seite 598 und 599:
3220 Mamillaria spreizend vorgestre
- Seite 600 und 601:
3222 Mamillaria Abb. 2988. Mamillar
- Seite 602 und 603:
3224 Mamillaria Abb. 2989. Mamillar
- Seite 604 und 605:
3226 Mamillaria danach müßte M. c
- Seite 606 und 607:
3228 Mamillaria Blüten hellrot mit
- Seite 608 und 609:
3230 Mamillaria Teilung vor. Solche
- Seite 610 und 611:
3232 Mamillaria Ob bloß eine Form
- Seite 612 und 613:
3234 Mamillaria östlich von Las De
- Seite 614 und 615:
3236 Mamillaria geschrieben). Pfeif
- Seite 616 und 617:
3238 Mamillaria Abb. 3000. Mamillar
- Seite 618 und 619:
3240 Mamillaria Bl. glockig, 15 mm
- Seite 620 und 621:
3242 Mamillaria 95. Mamillaria reko
- Seite 622 und 623:
3244 Mamillaria später mehr grau w
- Seite 624 und 625:
3246 Mamillaria Die Pflanze ist ebe
- Seite 626 und 627:
3248 Mamillaria Zu der hier gewähl
- Seite 628 und 629:
3250 Mamillaria Abb. 3008. Mamillar
- Seite 630 und 631:
3252 Mamillaria Abb. 3010. Mamillar
- Seite 632 und 633:
3254 Mamillaria e) v. intertexta (D
- Seite 634 und 635:
3256 Mamillaria mehr Rst. sowie nur
- Seite 636 und 637:
3258 Mamillaria Abb. 3020. Mamillar
- Seite 638 und 639:
3260 Mamillaria Abb. 3022. Mamillar
- Seite 640 und 641:
3262 Mamillaria Basis zuerst schwac
- Seite 642 und 643:
3264 Mamillaria Einzeln, von unten
- Seite 644 und 645:
3266 Mamillaria Abb. 3029. Mamillar
- Seite 646 und 647:
3268 Mamillaria Abb. 3031. Mamillar
- Seite 648 und 649:
3270 Mamillaria von Andreae, Benshe
- Seite 650 und 651:
3272 Mamillaria keulig, mit Periant
- Seite 652 und 653:
3274 Mamillaria gespitzt; Pet. 6, w
- Seite 654 und 655:
3276 Mamillaria Potosí, bei Soleda
- Seite 656 und 657:
3278 Mamillaria grünlichweiß, Mst
- Seite 658 und 659:
3280 Mamillaria (Baxt.) F. Buxb.,
- Seite 660 und 661:
3282 Mamillaria zisch, 1—3 cm lan
- Seite 662 und 663:
3284 Mamillaria schwarz, schief umg
- Seite 664 und 665:
3286 Mamillaria Abb. 3047. Mamillar
- Seite 666 und 667:
3288 Mamillaria Abb. 3050. „Mamil
- Seite 668 und 669:
3290 Mamillaria Körper von unten s
- Seite 670 und 671:
3292 Mamillaria der unterste vorges
- Seite 672 und 673:
3294 Mamillaria Spitzen, bis ganz s
- Seite 674 und 675:
3296 Mamillaria K. Schumann beschri
- Seite 676 und 677:
3298 Mamillaria Craig hat zu dieser
- Seite 678 und 679:
3300 Mamillaria von April bis zum A
- Seite 680 und 681:
3302 Mamillaria Abb. 3064. Mamillar
- Seite 682 und 683:
3304 Mamillaria bildung Fig. 164 vo
- Seite 684 und 685:
3306 Mamillaria Die spätere Beschr
- Seite 686 und 687:
3308 Mamillaria 140. Mamillaria wil
- Seite 688 und 689:
3310 Mamillaria 141. Mamillaria zei
- Seite 690 und 691:
3312 Mamillaria bisweilen hakenstac
- Seite 692 und 693:
3314 Mamillaria comb. nud. — Chil
- Seite 694 und 695:
3316 Mamillaria Craig fügt hinzu:
- Seite 696 und 697:
3318 Mamillaria S. schwarz, sehr kl
- Seite 698 und 699:
3320 Mamillaria ihnen zu tun, sonde
- Seite 700 und 701:
3322 Mamillaria Hilum, flach, rötl
- Seite 702 und 703:
3324 Mamillaria Abb. 3080. Mamillar
- Seite 704 und 705:
3326 Mamillaria dem hellgelbe Narbe
- Seite 706 und 707:
3328 Mamillaria Eine variable Art,
- Seite 708 und 709:
3330 Mamillaria Glanz, anfangs abst
- Seite 710 und 711:
3332 Mamillaria Einzeln, kugelig bi
- Seite 712 und 713:
3334 Mamillaria Abb. 3089. Mamillar
- Seite 714 und 715:
3336 Mamillaria hellgraugrün; W. z
- Seite 716 und 717:
3338 Mamillaria gelb; Gr. grün; N.
- Seite 718 und 719:
3340 Mamillaria Craigs Annahme, da
- Seite 720 und 721:
3342 Mamillaria Abb. 3095. Mamillar
- Seite 722 und 723:
3344 Mamillaria also gar nicht gena
- Seite 724 und 725:
3346 Mamillaria Abb. 3097. Mamillar
- Seite 726 und 727:
3348 Mamillaria Mamillaria pyrrhoch
- Seite 728 und 729:
3350 Mamillaria tha nach den Stache
- Seite 730 und 731:
3352 Mamillaria nis“, 8. 1935): M
- Seite 732 und 733:
3354 Mamillaria randig, spitz, lanz
- Seite 734 und 735:
3356 Mamillaria Narbenfarbe scheint
- Seite 736 und 737:
3358 Mamillaria Abb. 3107. Mamillar
- Seite 738 und 739:
3360 Mamillaria Abb. 3108. Mamillar
- Seite 740 und 741:
3362 Mamillaria spreizend; Mst. 2
- Seite 742 und 743:
3364 Mamillaria Abb. 3111. Mamillar
- Seite 744 und 745:
3366 Mamillaria Werdermann und Boed
- Seite 746 und 747:
3368 Mamillaria Varietäten aufgest
- Seite 748 und 749:
3370 Mamillaria Spitzen, nach unten
- Seite 750 und 751:
3372 Mamillaria Abb. 3118. Mamillar
- Seite 752 und 753:
3374 Mamillaria Abb. 3121. Mamillar
- Seite 754 und 755:
3376 Mamillaria Craig gibt an: auch
- Seite 756 und 757:
3378 Mamillaria bis rötlichgelb, u
- Seite 758 und 759:
3380 Mamillaria Die Blüten der von
- Seite 760 und 761:
3382 Mamillaria kenden Pflanzen. Au
- Seite 762 und 763:
3384 Mamillaria Abb. 3128. Mamillar
- Seite 764 und 765:
3386 Mamillaria Im Katalog 1947 fü
- Seite 766 und 767:
3388 Mamillaria sie übergeht“. D
- Seite 768 und 769:
3390 Mamillaria — v. albescens W.
- Seite 770 und 771:
3392 Mamillaria Mittellinie. Rand s
- Seite 772 und 773:
3394 Mamillaria seits abgeflacht, 5
- Seite 774 und 775:
3396 Mamillaria muster bildend, sch
- Seite 776 und 777:
3398 Mamillaria In der Sammlung Pal
- Seite 778 und 779:
3400 Mamillaria Der Besehreibung na
- Seite 780 und 781:
3402 Mamillaria 225. Mamillaria tie
- Seite 782 und 783:
3404 Mamillaria Von Craig nach eine
- Seite 784 und 785:
3406 Mamillaria 233. Mamillaria neo
- Seite 786 und 787:
3408 Mamillaria 234b. v. longispina
- Seite 788 und 789:
3410 Mamillaria Spitze, der Hauptms
- Seite 790 und 791:
3412 Mamillaria (Hildm.) Craig abbi
- Seite 792 und 793:
3414 Mamillaria rötlichbräunlich,
- Seite 794 und 795:
3416 Mamillaria 249. Mamillaria dia
- Seite 796 und 797:
3418 Mamillaria sten; Rst. 8—9, w
- Seite 798 und 799:
3420 Mamillaria 256a. v. brevispina
- Seite 800 und 801:
3422 Mamillaria Abb. 3160. Mamillar
- Seite 802 und 803:
3424 Mamillaria 3162 3163 Abb. 3162
- Seite 804 und 805:
3426 Mamillaria Abb. 3165. Mamillar
- Seite 806 und 807:
3428 Mamillaria glockig, 1,5 cm lan
- Seite 808 und 809:
3430 Mamillaria areolis ovalibus; a
- Seite 810 und 811:
3432 Mamillaria entspricht, die Cra
- Seite 812 und 813:
3434 Mamillaria 271. Mamillaria sol
- Seite 814 und 815:
3436 Mamillaria Abb. 3176. Mamillar
- Seite 816 und 817:
3438 Mamillaria Abb. 3178. Mamillar
- Seite 818 und 819:
3440 Mamillaria Abb. 3180. Mamillar
- Seite 820 und 821:
3442 Mamillaria Abb. 3182. Mamillar
- Seite 822 und 823:
3444 Mamillaria 4 cm breit (unten);
- Seite 824 und 825:
3446 Mamillaria nach Bz. 8 : 13, lo
- Seite 826 und 827:
3448 Mamillaria 289. Mamillaria cal
- Seite 828 und 829:
3450 Mamillaria Abb. 3190. Mamillar
- Seite 830 und 831:
3452 Mamillaria sie sowohl Herr W.
- Seite 832 und 833:
3454 Mamillaria 294. Mamillaria Ste
- Seite 834 und 835:
3456 Mamillaria rund, kahl; Ax. nac
- Seite 836 und 837:
3458 Mamillaria Abb. 3196. Mamillar
- Seite 838 und 839:
3460 Mamillaria Die 1953 abgebildet
- Seite 840 und 841:
3462 Mamillaria Ich führte die Art
- Seite 842 und 843:
3464 Mamillaria Vielleicht handelt
- Seite 844 und 845:
3466 Mamillaria gerade, untere gebo
- Seite 846 und 847:
3468 Mamillaria Mamillaria crebrisp
- Seite 848 und 849:
3470 Mamillaria Mamillaria eschanzi
- Seite 850 und 851:
3472 Mamillaria digen, die oberen 8
- Seite 852 und 853:
3474 Mamillaria nicht immer kürzer
- Seite 854 und 855:
3476 Mamillaria Craig vergleicht di
- Seite 856 und 857:
3478 Mamillaria Craig diskutiert di
- Seite 858 und 859:
3480 Mamillaria stärker wolligen S
- Seite 860 und 861:
3482 Mamillaria in der Länge sehr
- Seite 862 und 863:
3484 Mamillaria Mamillaria obliqua
- Seite 864 und 865:
3486 Mamillaria Mamillaria pleiocep
- Seite 866 und 867:
3488 Mamillaria Mamillaria seemanni
- Seite 868 und 869:
3490 Mamillaria Mamillaria tecta Mi
- Seite 870 und 871:
3492 Mamillaria habe, solche Synony
- Seite 872 und 873:
3494 Mamillaria Mamillaria daedalea
- Seite 874 und 875:
3496 Mamillaria Mamillaria rigida i
- Seite 876 und 877:
3498 Mamillaria Mamillaria bergeria
- Seite 878 und 879:
3500 Mamillaria Mamillaria hoffmann
- Seite 880 und 881:
Neobessega -> Neobesseya 3502 Mamil
- Seite 882 und 883:
3504 Porfiria — — vera Eng.: Co
- Seite 884 und 885:
3506 Porfiria Abb. 3215. Einzelpfla
- Seite 886 und 887:
3508 Krainzia Abb. 3217. Krainzia g
- Seite 888 und 889:
3510 Phellosperma angeheftet; Gr. n
- Seite 890 und 891:
3512 Dolichothele 3221 3222 Abb. 32
- Seite 892 und 893:
3514 Dolichothele des Genus Pseudom
- Seite 894 und 895:
3516 Dolichothele auch grün, sonst
- Seite 896 und 897:
3518 Dolichothele ler bzw. rötlich
- Seite 898 und 899:
3520 Dolichothele v. globosa (Lk.)
- Seite 900 und 901:
3522 Dolichothele 5. Dolichothele b
- Seite 902 und 903:
3524 Dolichothele 7. Dolichothele b
- Seite 904 und 905:
3526 Dolichothele Abb. 3230. Dolich
- Seite 906 und 907:
3528 Dolichothele Weicht von den be
- Seite 908 und 909:
3530 Dolichothele hängt damit die
- Seite 910 und 911:
3532 Dolichothele 1 mm breit, fein
- Seite 912 und 913:
3534 Bartschella beschrieben Britto
- Seite 914 und 915:
3536 Mamillopsis Spitzen; Blüten u
- Seite 916 und 917:
3538 Mamillopsis lieh, oben weiß o
- Seite 918 und 919:
3540 Cochemiea 1. Cochemiea halei (
- Seite 920 und 921:
3542 Cochemiea weiß, häufig mit d
- Seite 923:
Ta f e l a n h a n g
- Seite 926 und 927:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 928 und 929:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 930 und 931:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 932 und 933:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 934 und 935:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 936 und 937:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 938 und 939:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 940 und 941:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 942 und 943:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 944 und 945:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 946 und 947:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 948 und 949:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 950 und 951:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 952 und 953:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 954 und 955:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 956 und 957:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 958 und 959:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 960 und 961:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 962 und 963:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 964 und 965:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 966 und 967:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta
- Seite 968:
Backeberg, Die Cactaceae, Band V Ta