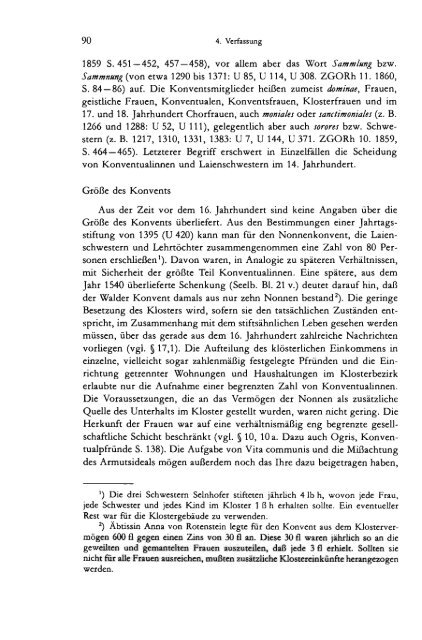- Seite 1 und 2:
GERMANIA SACRA HISTORISCH-STATISTIS
- Seite 3:
@) Gedruckt auf säurefreiem Papier
- Seite 7 und 8:
Vorwort ... Abkürzungen. 1. Quelle
- Seite 9:
Inhaltsverzeichnis 1. Mobilierunven
- Seite 12 und 13:
XII FAS fl ForschOberrhLdG F reibDi
- Seite 14 und 15:
XIV Sp. SpitalArch StaatsArchSig St
- Seite 16 und 17:
2 1. Quellen, Literatur, Denkmäler
- Seite 18:
4 1. Quellen, Literatur, Denkmäler
- Seite 21 und 22:
§ 1. Quellen 7 Derselbe Oberamtman
- Seite 23 und 24:
§ 2. Literatur 9 orte, über den E
- Seite 25 und 26:
§ 2. Literatur 11 Glaeser Otto, Di
- Seite 27 und 28:
§ 2. Literatur 13 Lekai Ludwig J.
- Seite 29 und 30:
S y d 0 w J ürgen, s. Germania Sac
- Seite 31 und 32:
§ 3. Denkmäler 17 Altar standen.
- Seite 33 und 34:
§ 3. Denkmäler 19 2. Altäre der
- Seite 35 und 36:
§ 3. Denkmäler 21 Südlicher Seit
- Seite 37 und 38:
§ 3. Denkmäler 23 Pinnosa, Doroth
- Seite 39 und 40:
§ 3. Denkmäler 25 gehalten werde
- Seite 41 und 42:
§ 3. Denkmäler 27 Innenausstattun
- Seite 43:
§ 3. Denkmäler 29 Vorhang, mit Ki
- Seite 46 und 47:
32 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 48 und 49:
34 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 50 und 51:
36 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 52 und 53:
38 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 54 und 55: 40 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 56 und 57: 42 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 58 und 59: 44 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 60 und 61: 46 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 62 und 63: 48 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 64: 50 1. Quellen, Literatur, Denkmäle
- Seite 67 und 68: § 3. Denkmäler 53 häusle (Staats
- Seite 69 und 70: § 3. Denkmäler 55 Im Jahr 1692 wu
- Seite 71 und 72: § 3. Denkmäler 57 pflegung, Heizm
- Seite 73 und 74: § 3. Denkmäler 59 aus einem Eintr
- Seite 76 und 77: 62 2. Archiv und Bibliothek äußer
- Seite 78 und 79: 64 2. Archiv und Bibliothek Seit Be
- Seite 80 und 81: 66 3. Historische Übersicht heißt
- Seite 82 und 83: 68 3. Historische Übersicht weibli
- Seite 84 und 85: 70 3. Historische Übersicht Rehfus
- Seite 86 und 87: 72 3. Historische Übersicht ca. 12
- Seite 88 und 89: 74 3. Historische Übersicht dert n
- Seite 90 und 91: 76 3. Historische Übersicht Mit de
- Seite 92 und 93: 78 3. Historische Übersicht in die
- Seite 94 und 95: 80 3. Historische Übersicht gelege
- Seite 96 und 97: 82 3. Historische Übersicht panie
- Seite 98 und 99: 84 3. Historische Übersicht nimmt
- Seite 100 und 101: 86 3. Historische Übersicht Die bi
- Seite 102 und 103: 88 3. Historische Übersicht Neuver
- Seite 106 und 107: 92 4. Verfassung recht. Kraft der G
- Seite 108 und 109: 94 4. Verfassung hatten (vorderöst
- Seite 110 und 111: 96 4. Verfassung gen die Stellungna
- Seite 112 und 113: 98 4. Verfassung Kurie einen neuen
- Seite 114 und 115: 100 4. Verfassung Einkleidung in da
- Seite 117: § 10. Klostergemeinschaft 103 dier
- Seite 120 und 121: 106 4. Verfassung . entschied. Ansc
- Seite 122 und 123: 108 4. Verfassung Im 18. Jahrhunder
- Seite 124 und 125: 110 4. Verfassung nenkapitel und vo
- Seite 126 und 127: 112 4. Verfassung tafeln mit aufgen
- Seite 128 und 129: 114 4. Verfassung Aufnahme und Prof
- Seite 130 und 131: 116 4. Verfassung hätten (Memorial
- Seite 132 und 133: 118 4. Verfassung stets nur als Zeu
- Seite 134 und 135: 120 4. Verfassung Der Beichtvater m
- Seite 137 und 138: § 10. Klostergemeinschaft 123 setz
- Seite 139 und 140: § 10. Klostergemeinschaft 125 In W
- Seite 141 und 142: § 10. Klostergemeinschaft 127 S. 1
- Seite 143 und 144: § 10. Klostergemeinschaft 129 Pfr
- Seite 145 und 146: § 10. Klostergemeinschaft 131 siku
- Seite 147 und 148: § 10. Klostergemeinschaft 133 glei
- Seite 150 und 151: 136 4. Verfassung Andere bürgerlic
- Seite 152 und 153: 138 4. Verfassung Schienen zu Schro
- Seite 154 und 155:
140 4. Verfassung gewollt hätten,
- Seite 156 und 157:
142 4. Verfassung linger zeigen: Ju
- Seite 158 und 159:
144 4. Verfassung Vater inne: Die d
- Seite 160 und 161:
146 4. Verfassung Konvent ihres Pat
- Seite 162 und 163:
148 4. Verfassung lässigen Angaben
- Seite 164:
150 4. Verfassung 17. Jahrhundert i
- Seite 167 und 168:
§ 11. Würden und Ämter 153 Regie
- Seite 169 und 170:
§ 11. Würden und Ämter 155 oberd
- Seite 171:
§ 11. Würden und Ämter 157 mit d
- Seite 174 und 175:
160 4. Verfassung Abteischlüssel,
- Seite 176 und 177:
162 4. Verfassung ihrerseits den vo
- Seite 178:
164 4. Verfassung 1739 zurück, der
- Seite 181:
§ 11. Würden und Ämter 167 bekom
- Seite 185 und 186:
§ 11 . Würden und Ämter 171 mit
- Seite 187 und 188:
§ 11. Würden und Ämter 173 traf
- Seite 189 und 190:
§ 11. Würden und Ämter 175 Das P
- Seite 191 und 192:
§ 11. Würden und Ämter 177 Im Ja
- Seite 193 und 194:
§ 11. Würden und Ämter 179 Unter
- Seite 195 und 196:
§ 11. Würden und Ämter 181 die G
- Seite 197 und 198:
§ 11. Würden und Ämter 183 Profe
- Seite 199 und 200:
§ 11. Würden und Ämter 185 Im Ja
- Seite 201 und 202:
§ 11. Würden und Ämter 187 Kelle
- Seite 203 und 204:
§ 12. Klösterliche Ausstattung 18
- Seite 206:
192 4. Verfassung Zusätzlich zur A
- Seite 210 und 211:
196 4. Verfassung und -verträgen g
- Seite 212 und 213:
198 4. Verfassung doch dürften auc
- Seite 214 und 215:
200 4. Verfassung dung der Frauen a
- Seite 217 und 218:
§ 12. Klösterliche Ausstattung 20
- Seite 219 und 220:
§ 13. Stellung im Orden 205 Der Ab
- Seite 221 und 222:
§ 13. Stellung im Orden 207 werden
- Seite 223 und 224:
§ 13. Stellung im Orden 209 Person
- Seite 225 und 226:
§ 13. Stellung im Orden 211 U 12,
- Seite 227 und 228:
§ 13. Stellung im Orden 213 besch
- Seite 229 und 230:
§ 13. Stellung im Orden 215 III. a
- Seite 232 und 233:
218 4. Verfassung Charten für die
- Seite 234 und 235:
220 4. Verfassung Erbhuldigung der
- Seite 236 und 237:
222 4. Verfassung ihrer Hilfe 1768
- Seite 238:
224 4. Verfassung lungen wieder abz
- Seite 241 und 242:
§ 13. Stellung im Orden 227 78,225
- Seite 243 und 244:
§ 13. Stellung im Orden 229 den Va
- Seite 246 und 247:
232 4. Verfassung mische Pater Sekr
- Seite 248 und 249:
234 4. Verfassung Aufgrund des von
- Seite 253:
§ 13. Stellung im Orden 239 bereit
- Seite 256 und 257:
242 4. Verfassung Änderung der Pat
- Seite 258 und 259:
244 4. Verfassung bestätigen, als
- Seite 260 und 261:
246 4. Verfassung bestätigte den A
- Seite 262 und 263:
248 4. Verfassung geschlossenen Ver
- Seite 264 und 265:
250 4. Verfassung Fürst Maximilian
- Seite 266 und 267:
252 4. Verfassung nach der Verleihu
- Seite 268 und 269:
254 4. Verfassung fünfziger und se
- Seite 270 und 271:
256 4. Verfassung den Prälaten von
- Seite 272:
258 4. Verfassung reichische Besteu
- Seite 275 und 276:
§ 16. Siegel und Wappen 261 gelese
- Seite 277 und 278:
§ 16. Siegel und Wappen 263 Famili
- Seite 279:
§ 16. Siegel und Wappen 265 Konven
- Seite 282 und 283:
268 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 284 und 285:
270 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 286 und 287:
272 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 288 und 289:
274 s. Religiöses und geistiges Le
- Seite 290 und 291:
276 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 292 und 293:
278 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 294 und 295:
280 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 296 und 297:
282 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 298 und 299:
284 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 300 und 301:
286 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 302 und 303:
288 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 304 und 305:
290 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 306 und 307:
292 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 308 und 309:
294 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 311 und 312:
§ 17. Innerklösterliches Leben 29
- Seite 313 und 314:
§ 17. Innerklösterliches Leben 29
- Seite 315 und 316:
§ 17. Innerklösterliches Leben 30
- Seite 318 und 319:
304 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 320 und 321:
306 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 322 und 323:
308 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 324:
310 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 327 und 328:
§ 18. Gottesdienst 313 zusammengel
- Seite 329 und 330:
§ 18. Gottesdienst 315 Wald 78,2)
- Seite 332 und 333:
318 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 334:
320 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 337 und 338:
§ 19. Wallfahrten und Prozessionen
- Seite 339 und 340:
§ 19. Wallfahrten und Prozessionen
- Seite 341 und 342:
§ 21. Reliquien 327 Zu allen bisch
- Seite 343 und 344:
§ 21 . Reliquien 329 Mariens und v
- Seite 345 und 346:
§ 21. Reliquien 331 Wald zu dem Re
- Seite 347 und 348:
§ 21. Reliquien 333 und Untertanen
- Seite 349 und 350:
§ 21 . Reliquien 335 aufgrund der
- Seite 351 und 352:
§ 21 . Reliquien 337 vom Ordens ge
- Seite 353:
§ 22. Almosen 339 1664/6519 fl. 17
- Seite 356 und 357:
342 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 358 und 359:
344 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 360 und 361:
346 S. Religiöses und geistiges Le
- Seite 363 und 364:
§ 24. Besitzentwicklung und Einkü
- Seite 365 und 366:
§ 24. Besitzentwicklung und Einkü
- Seite 367 und 368:
§ 24. Besitzentwicklung und Einkü
- Seite 374 und 375:
360 Baumaterialien: 382 fl 3 kr Kle
- Seite 376 und 377:
362 6. Der Besitz chen. Im Jahr 132
- Seite 378:
364 6. Der Besitz dem 16. Jahrhunde
- Seite 381 und 382:
§ 25. Bewirtschaftung und Verwaltu
- Seite 383 und 384:
§ 26. Klösterliche Gerichts- und
- Seite 385 und 386:
§ 26. Klösterliche Gerichts- und
- Seite 387 und 388:
§ 26. Klösterliche Gerichts- und
- Seite 389 und 390:
§ 27. Liste des Klosterbesitzes 37
- Seite 392 und 393:
378 6. Der Besitz pf seinen Weingar
- Seite 394 und 395:
380 6. Der Besitz von Rohrdorf, den
- Seite 396 und 397:
382 6. Der Besitz (137,2. StaatsArc
- Seite 399 und 400:
§ 27. Liste des Klosterbesitzes 38
- Seite 401 und 402:
§ 27. Liste des Klosterbesitzes 38
- Seite 408 und 409:
394 6. Der Besitz vermitteln den Ka
- Seite 412:
398 6. Der Besitz Frobenius von Fü
- Seite 416 und 417:
402 6. Der Besitz Reichenstein an d
- Seite 422:
408 6. Der Besitz 1322 verkaufen di
- Seite 425:
§ 27. Liste des Klosterbesitzes 41
- Seite 434 und 435:
420 6. Der Besitz kauft der Überli
- Seite 436:
422 6. Der Besitz der Kirche aus; d
- Seite 440 und 441:
426 6. Der Besitz § 28. Abhängige
- Seite 442 und 443:
428 6. Der Besitz 1702 wurde in Gla
- Seite 444 und 445:
430 6. Der Besitz Ren g e t s weil
- Seite 446 und 447:
432 6. Der Besitz Der Walbertsweile
- Seite 448 und 449:
434 6. Der Besitz des 18. Jahrhunde
- Seite 450 und 451:
436 6. Der Besitz 1439), 1806 die G
- Seite 452:
438 6. Der Besitz allem manche der
- Seite 456 und 457:
442 6. Der Besitz Muschelkappen (30
- Seite 459:
§ 30. Inventare 445 (45 kr); ein k
- Seite 462 und 463:
448 6. Der Besitz Tuch; kann in ein
- Seite 465:
§ 30. Inventare 451 Das Verzeichni
- Seite 469 und 470:
§ 30. Inventare 455 Im unteren Gas
- Seite 473 und 474:
§ 30. Inventare 459 Unteres innere
- Seite 475 und 476:
§ 30. Inventare 461 runter der Non
- Seite 477 und 478:
§ 31. Katalog der Äbtissinnen 463
- Seite 479 und 480:
§ 31 . Katalog der Äbtissinnen 46
- Seite 481:
§ 31. Katalog der Äbtissinnen 467
- Seite 485 und 486:
§ 31. Katalog der Äbtissinnen 471
- Seite 487 und 488:
§ 31. Katalog der Äbtissinnen 473
- Seite 490 und 491:
476 7. Personallisten Siegel: Sowei
- Seite 492 und 493:
478 7. Personallisten Helmdecken, h
- Seite 494:
480 7. Personallisten Statthalter d
- Seite 497 und 498:
§ 31. Katalog der Äbtissinnen 483
- Seite 499 und 500:
§ 31. Katalog der Äbtissinnen 485
- Seite 502 und 503:
488 7. Personallisten Maria Josefa
- Seite 504 und 505:
490 7. Personallisten Maria Crescen
- Seite 506 und 507:
492 7. Personallisten Maria Anna Ba
- Seite 508 und 509:
494 7. Personallisten 16. Apotheker
- Seite 510 und 511:
496 7. Personallisten Konfektmeiste
- Seite 512 und 513:
498 7. Personallisten oder Hofmeist
- Seite 515 und 516:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 517 und 518:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 519 und 520:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 522:
508 7. Personallisten und seine Fra
- Seite 525 und 526:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 527:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 531 und 532:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 533 und 534:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 535 und 536:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 537:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 540:
526 7. Personallisten ßung dem Klo
- Seite 544 und 545:
530 7. Personallisten Hechingen, ih
- Seite 546 und 547:
532 7. Personallisten Hafner, Stift
- Seite 548 und 549:
534 7. Personallisten Reischach S.
- Seite 550 und 551:
536 7. Personallisten Sigmaringen u
- Seite 552 und 553:
538 7. Personallisten den Landadel
- Seite 554 und 555:
540 7. Personallisten vorgegangene
- Seite 556 und 557:
542 7. Personallisten Die Schienen
- Seite 559 und 560:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 561 und 562:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 563 und 564:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 566 und 567:
552 7. Personallisten polz, bischö
- Seite 568 und 569:
554 7. Personallisten tischen Oberv
- Seite 570 und 571:
556 7. Personallisten mutlich am 29
- Seite 572 und 573:
558 7. Personallisten ArchSig Ho 15
- Seite 574 und 575:
560 7. Personallisten 1771 vermerkt
- Seite 576 und 577:
562 7. Personallisten von Alberti,
- Seite 578 und 579:
564 7. Personallisten ster des Kemp
- Seite 582 und 583:
568 7. Personallisten obgleich er a
- Seite 584 und 585:
570 7. Personallisten Maria Johanna
- Seite 586 und 587:
572 7. Personallisten Tochter zur V
- Seite 588 und 589:
574 7. Personallisten Schwester Mar
- Seite 590 und 591:
576 7. Personallisten Maria Elisabe
- Seite 592 und 593:
578 7. Personallisten Sie trat am 1
- Seite 594 und 595:
580 7. Personallisten den war, jedo
- Seite 596 und 597:
582 7. Personallisten (78,280). 1.
- Seite 599 und 600:
§ 33. Katalog der Konventualinnen
- Seite 602 und 603:
588 7. Personallisten Sanctia Rueth
- Seite 604 und 605:
590 7. Personallisten Anna Maria Ei
- Seite 606 und 607:
592 7. Personallisten Michael Breid
- Seite 608 und 609:
594 7. Personallisten weltliche Pro
- Seite 610 und 611:
596 7. Personallisten Aufnahme als
- Seite 612 und 613:
598 7. Personallisten empfohlen wor
- Seite 614 und 615:
600 7. Personallisten Theresias als
- Seite 616:
602 7. Personallisten Mädchen, dem
- Seite 619 und 620:
§ 36. Katalog der Kapläne und Bei
- Seite 621 und 622:
§ 37. Katalog der Laienbrüder 607
- Seite 623 und 624:
§ 37. Katalog der Laienbrüder 609
- Seite 625:
§ 37. Katalog der Laienbrüder 611
- Seite 629 und 630:
§ 38. Katalog der Pfründner und P
- Seite 631 und 632:
§ 38. Katalog der Pfründner und P
- Seite 633:
§ 38. Katalog der Pfründner und P
- Seite 636 und 637:
622 7. Personallisten Konrad Hätzl
- Seite 638 und 639:
624 7. Personallisten Ottilie Küch
- Seite 641 und 642:
§ 38. Katalog der Pfründner und P
- Seite 643 und 644:
§ 38. Katalog der Pfründner und P
- Seite 646:
632 7. Personallisten tionen Weißb
- Seite 649:
§ 39. Katalog der Oblatinnen und K
- Seite 652 und 653:
A Aach, Kr. Konstanz 136, 270, 376,
- Seite 654 und 655:
640 Register Albert v. Winterlingen
- Seite 656 und 657:
642 Register Anniversarien s. Jahrz
- Seite 659 und 660:
Bertold, Lb. zu W. (1266) 607 f. Be
- Seite 663 und 664:
Burst s. a. Hans, Heinrich, Konrad
- Seite 665 und 666:
v. Donnersberg Franz Bernhard 565 v
- Seite 667 und 668:
Elisabeth Suberknecht, Ls. zu W. 14
- Seite 671:
Gastgebäude, -haus 283 f. - s. a.
- Seite 675 und 676:
Haigerloch, Zollernalbkreis 146, 48
- Seite 678 und 679:
664 Register Heinrich der Raster 40
- Seite 681 und 682:
Hohenzollern, Fürstentümer 87 f.,
- Seite 685 und 686:
s. a. Albrecht 1., Ferdinand 1., Fe
- Seite 688:
674 Register Klosterbrand 17, 52 f.
- Seite 692:
678 Register Kreuzlingen (Kt. Thurg
- Seite 699 und 700:
Nenzingen (Orsingen-Nenzingen), Kr.
- Seite 702 und 703:
688 Register Ortolf v. Heudorf zu W
- Seite 704 und 705:
690 Register KapuzinerinnenKl. Herz
- Seite 707:
v. Reischach Ursula, N. zu W. 378,
- Seite 713 und 714:
Schleicher Ursula Dorothea, geb. Bu
- Seite 716 und 717:
702 Register Shonherr s. a. Schonhe
- Seite 718 und 719:
704 Register württembergische Land
- Seite 724:
710 Register Pfarrei 47,208,332,427
- Seite 728 und 729:
714 Register Wyg s. a. Wig Wygy s.
- Seite 730 und 731:
Abb. 1: Kloster Wald 1681 /1685, Ze