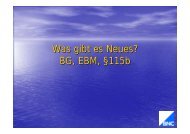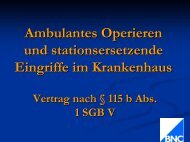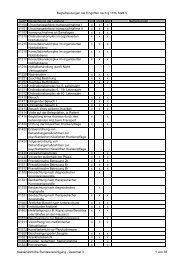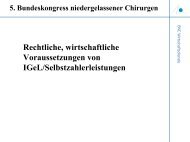- Seite 1:
Koordination und Qualität im Gesun
- Seite 5:
Inhaltsübersicht Danksagung 7 Glie
- Seite 8 und 9:
Der Rat dankt auch den Mitarbeiteri
- Seite 10 und 11:
2.5.1 Alternative Steuerungsmechani
- Seite 12 und 13:
4.3.4 Salutogenese 218 4.3.5 Modell
- Seite 14 und 15:
5.5 Die demographische Entwicklung
- Seite 16 und 17:
7.6 Ökonomische und strukturelle R
- Seite 18 und 19:
Tabelle 27: Soziale Schicht und Ban
- Seite 20 und 21:
Tabelle 76: Ausgabenanteile in der
- Seite 22 und 23:
Abbildung 25: Dynamisierung der Lei
- Seite 25 und 26:
Abkürzungsverzeichnis AABG Arzneim
- Seite 27 und 28:
GOÄ Gebührenordnung für Ärzte G
- Seite 29 und 30:
1. Einleitung: Steigerung der Verso
- Seite 31 und 32:
Morbidität einwirken, nicht im Ges
- Seite 33 und 34:
men aber per saldo eher zu als ab.
- Seite 35 und 36:
14. Die Forschungslage zur sozial b
- Seite 37 und 38:
ung zu geben. Darüber hinaus lasse
- Seite 39 und 40:
26. Die Basis zur Finanzierung des
- Seite 41 und 42:
artige Pauschalen für den Wettbewe
- Seite 43:
qualitätsgesicherter, einfach zug
- Seite 46 und 47:
schaftlichen Verträge, sondern ihr
- Seite 48 und 49:
2.2 Die korporative Koordination al
- Seite 50 und 51:
ziger Jahre ein und das Gesundheits
- Seite 52 und 53:
mation bis zur Aushandlung konkrete
- Seite 54 und 55:
davon ab, welche Position die jewei
- Seite 56 und 57:
zur Durchsetzung der wirtschaftlich
- Seite 58 und 59:
Den stärksten Zuwachs an korporati
- Seite 60 und 61:
− den Erlass einer Verfahrensordn
- Seite 62 und 63:
62 Bei vorgegebenen Budgets sinkt b
- Seite 64 und 65:
sen bietet zwar im internationalen
- Seite 66 und 67:
gegenüber. Im Sinne von Effizienz
- Seite 68 und 69:
tenträgerrechnung sowie einer krit
- Seite 70 und 71:
Voraussetzung bildet, hängt nicht
- Seite 72 und 73:
einem willkürlichen bzw. unverhäl
- Seite 74 und 75:
ots ab. Das absolute und relative W
- Seite 76 und 77:
Schließlich kann die staatliche Ra
- Seite 78 und 79:
stande kommen, dass die Patienten d
- Seite 80 und 81:
xen erhöhen die Verhandlungsmacht
- Seite 82 und 83:
hält die jeweils beteiligten Leist
- Seite 84 und 85:
Von diesen alternativen Steuerungsm
- Seite 86 und 87:
Ärzteverbände, entbunden von den
- Seite 88 und 89:
pflichtigen Einnahmen nicht übersc
- Seite 90 und 91:
Abbildung 2: Wachstum der GKV-Leist
- Seite 92 und 93:
eicher, mühsamer und ergebnisärme
- Seite 94 und 95:
94 auch der ursprünglich verfolgte
- Seite 96 und 97:
tegrierte Versorgung an, die im Fal
- Seite 98 und 99:
ner Kontrollen entweder durch die
- Seite 100 und 101:
Gegenstand kartellrechtlicher Verfa
- Seite 102 und 103:
Hilfsmitteln im Wesentlichen der Ma
- Seite 104 und 105:
− Die gemeinsame Selbstverwaltung
- Seite 106 und 107:
106. Da alle gesamtwirtschaftlichen
- Seite 108 und 109:
lungen führen. Der völlige oder t
- Seite 110 und 111:
110 Eucken, W. (1960): Grundsätze
- Seite 112 und 113:
112 Löwisch, M., Hrsg. (1999): Wet
- Seite 114 und 115:
114
- Seite 116 und 117:
Um besonders belastete Bevölkerung
- Seite 118 und 119:
gang des entsprechenden Anteils in
- Seite 120 und 121:
3.2 Empirische Ergebnisse aus Deuts
- Seite 122 und 123:
(vgl. Tabelle 3). Bei statistischer
- Seite 124 und 125:
und in den höheren Altersgruppen d
- Seite 126 und 127:
Tabelle 6: Beruflicher Status und T
- Seite 128 und 129:
3.3 Empirische Ergebnisse aus Deuts
- Seite 130 und 131:
Die Fragen zum Gesundheitszustand b
- Seite 132 und 133:
3.3.2.2 Ergebnisse für Erwachsene
- Seite 134 und 135:
en, dass pro Stichprobe nur ca. 5.1
- Seite 136 und 137:
kasse‘ zeigt, dass der Nachweis g
- Seite 138 und 139:
Tabelle 15: Soziale Schicht und Dia
- Seite 140 und 141:
Krebslokalisationen, z. B. Magen-/D
- Seite 142 und 143:
Aus der ‚Deutschen Mundgesundheit
- Seite 144 und 145:
Tabelle 20: Schulbildung der Eltern
- Seite 146 und 147:
Tabelle 21: Schulbildung der Eltern
- Seite 148 und 149:
3.3.9 Hauterkrankungen 134. Ähnlic
- Seite 150 und 151:
zug auf den oben dargestellten Zusa
- Seite 152 und 153:
3.3.11 Erkrankungen des Stütz- und
- Seite 154 und 155:
Insgesamt ergab sich eine Prävalen
- Seite 156 und 157:
Eine allgemeinere und ungenauere Er
- Seite 158 und 159:
als bei der ‚Lebenszeit-Prävalen
- Seite 160 und 161:
Jugendlichen als auch bei Erwachsen
- Seite 162 und 163:
Tabelle 33: Ausbildungsdauer und Ve
- Seite 164 und 165:
Tabelle 35: Soziale Schicht und sta
- Seite 166 und 167:
Tabelle 37: Soziale Schicht und Hyp
- Seite 168 und 169:
genen Analyse wurden diese Angaben
- Seite 170 und 171:
Schicht signifikant häufiger ist a
- Seite 172 und 173:
In den letzten Jahren ist in der Pu
- Seite 174 und 175:
völkerungsgruppen richten, führen
- Seite 176 und 177:
Greiner, B., (2001): Psychosoziale
- Seite 178 und 179:
Micheelis, W, Bauch J (Gesamtbearbe
- Seite 180 und 181:
180
- Seite 182 und 183:
Die Komplexität der Ätiologie und
- Seite 184 und 185:
von medizinisch-technischem Fortsch
- Seite 186 und 187:
(sedentary lifestyles) anhielt und
- Seite 188 und 189:
− umweltbezogener Gesundheitsschu
- Seite 190 und 191:
190 b) Integration von Verhältnis-
- Seite 192 und 193:
4.1.2.3 Gesundheitsförderung 169.
- Seite 194 und 195:
zw. Gebühren angebotene Infrastruk
- Seite 196 und 197:
Exkurs: Verhältnis von Prävention
- Seite 198 und 199:
Ambulante und stationäre Vorsorgel
- Seite 200 und 201:
Exkurs: Prävention neuer und wiede
- Seite 202 und 203:
nahmen, um deren Qualität, aber au
- Seite 204 und 205:
operates. It is perhaps the most my
- Seite 206 und 207:
klärbares Phänomen. Nicht abschli
- Seite 208 und 209:
chen Wachstum, das die soziale und
- Seite 210 und 211:
nach diesem Ansatz aber mit jedem S
- Seite 212 und 213:
der individuellen Primärpräventio
- Seite 214 und 215:
schreiben und erklären dynamische
- Seite 216 und 217:
− Einstellungen, d. h. Ansichten
- Seite 218 und 219:
in enger Beziehung. Auf das Selbstw
- Seite 220 und 221:
Tabelle 45: Ausgewählte Ergebnisse
- Seite 222 und 223:
ven Bewertung und mit objektiven In
- Seite 224 und 225:
schaffen (Siegrist, J. et al. 1998)
- Seite 226 und 227:
Die in Tabelle 46 beschriebenen Sta
- Seite 228 und 229:
236. Interventionen, die auf Modell
- Seite 230 und 231:
4.4 Gesundheitskommunikation, sozia
- Seite 232 und 233:
‚Mehr-Ebenen‘-Kampagne, die sic
- Seite 234 und 235:
Unterschieden in den Gesundheitsbel
- Seite 236 und 237:
Über diese Kampagnen hinaus wurden
- Seite 238 und 239:
Die Aussagekraft von Preisen im Ges
- Seite 240 und 241:
Quantifizierung der Krankheitslast
- Seite 242 und 243:
gemessen am Volumen weniger bedeute
- Seite 244 und 245:
Exkurs: Tabakrahmenkonvention der W
- Seite 246 und 247:
Strategien und Instrumente der Alko
- Seite 248 und 249:
4.4.4.4 Übergewicht und Adipositas
- Seite 250 und 251:
wegung bietet vor allem das Setting
- Seite 252 und 253:
ei Männern zu, wobei das Aktivitä
- Seite 254 und 255:
4.5 Betriebliche Gesundheitspolitik
- Seite 256 und 257:
Hälfte, in mehreren Ländern rund
- Seite 258 und 259:
der Spitzenverbände der GKV, Abspr
- Seite 260 und 261:
ewerb der Krankenkassen ausgelöste
- Seite 262 und 263:
(Zoike, E. 2002). Diese Datenbasis
- Seite 264 und 265:
keit werden maßgeblich von Alter u
- Seite 266 und 267:
Weiterentwicklung der arbeitsweltbe
- Seite 268 und 269:
318. Die Effektivität von betriebl
- Seite 270 und 271:
etroffener Personen führen. Missbr
- Seite 272 und 273:
Tabelle 49: Merkmale ‚gesunder‘
- Seite 274 und 275:
Abbildung 6: Integration von betrie
- Seite 276 und 277:
Empfehlungen an die Sozialpartner D
- Seite 278 und 279:
331. Die kommunale Gesundheitspolit
- Seite 280 und 281:
335. Aktivitäten in Settings sollt
- Seite 282 und 283:
Tabelle 50: Lebensraumbezogene Bed
- Seite 284 und 285:
4.6.2 Netzwerk ‚gesunder Städte
- Seite 286 und 287:
(z. B. Senatsverwaltung Berlin 2004
- Seite 288 und 289:
Abbildung 9: Zielgruppen der Angebo
- Seite 290 und 291:
Abbildung 11: Verbesserung des indi
- Seite 292 und 293:
‚Entwicklung und Chancen junger M
- Seite 294 und 295:
stützt werden. 82 In diesem Zusamm
- Seite 296 und 297:
Komplexität der Primärprävention
- Seite 298 und 299:
365. Evaluiert wurden bisher vor al
- Seite 300 und 301:
Abbildung 13: Dokumentation der Ang
- Seite 302 und 303:
wertet die verfügbare Evidenz zu b
- Seite 304 und 305:
Abbildung 15: Public Health Action
- Seite 306 und 307:
Anliegen der Primärprävention in
- Seite 308 und 309:
383. Für verschiedene sozioökonom
- Seite 310 und 311:
4.8.2.2 Alkohol und Alkoholsteuern
- Seite 312 und 313:
390. Im Zuge von Überlegungen zur
- Seite 314 und 315:
Subventionierung von Produkten und
- Seite 316 und 317:
satz eingeführt und durch das GMG
- Seite 318 und 319:
des in § 20 SGB V vorgegebenen Zie
- Seite 320 und 321:
eine betriebswirtschaftliche bzw. u
- Seite 322 und 323:
4.8.3 Anreize für Anbieter im Gesu
- Seite 324 und 325:
nannt. Daher sollten neben der Bere
- Seite 326 und 327:
Stellenwert der prädiktiven geneti
- Seite 328 und 329:
− Investition in Gesundheit als e
- Seite 330 und 331:
330 b) Integration von Verhältnis-
- Seite 332 und 333:
unterstützen, liegen nicht vor bzw
- Seite 334 und 335:
434. Soweit sich Interventionen all
- Seite 336 und 337:
440. Seit den 1950er Jahren wurden
- Seite 338 und 339:
zw. die Zahl der aufgrund von Arbei
- Seite 340 und 341:
452. Die kommunale Gesundheitspolit
- Seite 342 und 343:
Die einzelnen Phasen dieses Zyklus
- Seite 344 und 345:
Krankenkasse günstigen Verhältnis
- Seite 346 und 347:
Primärprävention als gesellschaft
- Seite 348 und 349:
4.10 Literatur 348 Abel, T., Kolip,
- Seite 350 und 351:
350 Bertelsmann Stiftung und Hans-B
- Seite 352 und 353:
352 Curtice, L., Springett, J., Ken
- Seite 354 und 355:
354 Frey, B.S. und Benz, M. (2001):
- Seite 356 und 357:
356 Helmert, U. und Strube, H. (200
- Seite 358 und 359:
358 Komlos, J. and Baur, M. (2003):
- Seite 360 und 361:
360 McQueen, D.V. and Anderson, L.M
- Seite 362 und 363:
362 Pallant, J.F. and Lae, L. (2002
- Seite 364 und 365:
364 Rosenbrock, R. und Geene, R. (2
- Seite 366 und 367:
366 Siegrist, J. (2003): Arbeitsbed
- Seite 368 und 369:
368 UPI Umwelt- und Prognose-Instit
- Seite 370 und 371:
370 WHO (2004c): What are the most
- Seite 372 und 373:
und versorgungsbedürftige Migrante
- Seite 374 und 375:
sich die Verhandlungen über den Um
- Seite 376 und 377:
samt 69 Artikel, das SGB XI ist der
- Seite 378 und 379:
die Erleichterung des Zugangs, die
- Seite 380 und 381:
‚Satt- und- Sauber-Pflege‘ nich
- Seite 382 und 383:
Tabelle 52: Stufen der Pflegebedür
- Seite 384 und 385:
5.2.4 Leistungen der sozialen Pfleg
- Seite 386 und 387:
498. Bei Pflegesachleistungen hande
- Seite 388 und 389:
388 − Blutzuckermessungen bei Ers
- Seite 390 und 391:
ausreichende Beratungszeit, um alle
- Seite 392 und 393:
kräfte aus den Beitrittsstaaten ha
- Seite 394 und 395:
510. Bei erheblicher Pflegebedürft
- Seite 396 und 397:
zufrieden. Ein Drittel ist mit sein
- Seite 398 und 399:
der Haushalte sprechen sich für ei
- Seite 400 und 401:
Der befürwortete und erwartete Str
- Seite 402 und 403:
chen Zuzahlungsbeträge können daz
- Seite 404 und 405:
nur 100 Tagespflegeeinrichtungen un
- Seite 406 und 407:
534. Angehörige und professionelle
- Seite 408 und 409:
im Vergleich zu Einrichtungen der s
- Seite 410 und 411:
arbeitet das Deutsche Netzwerk für
- Seite 412 und 413:
2003). Prognosen bzw. modellhafte V
- Seite 414 und 415:
Tabelle 54: Entwicklung des Sterbea
- Seite 416 und 417:
derungssaldo stützt sich die Vorau
- Seite 418 und 419:
Tabelle 56: Die Entwicklung des Alt
- Seite 420 und 421:
Er steigt nach der mittleren Varian
- Seite 422 und 423:
551. Da die Leistungsprofile der Pf
- Seite 424 und 425:
Abbildung 20: Zur Entwicklung der S
- Seite 426 und 427:
Abbildung 22: Entwicklung der Leist
- Seite 428 und 429:
zu erwartenden Wandel der demograph
- Seite 430 und 431:
Tabelle 60: Gegenüberstellung der
- Seite 432 und 433:
es ein ergänzender Jahresausgleich
- Seite 434 und 435:
chen Beitrag von 0,25 Prozentpunkte
- Seite 436 und 437:
derselben Leistung durch die GKV li
- Seite 438 und 439:
In der Pflegeversicherung liegt der
- Seite 440 und 441:
tenzials der Pflegebedürftigen und
- Seite 442 und 443:
habilitationsempfehlungen nicht aus
- Seite 444 und 445:
585. Die Demenz ist eine fortschrei
- Seite 446 und 447:
588. Schon jetzt zählen Demenzen u
- Seite 448 und 449:
der Anamnese, der Fremdanamnese, de
- Seite 450 und 451:
450 − normaler Liquor in den Stan
- Seite 452 und 453:
5.8.3 Krankheitsverlauf 605. Die De
- Seite 454 und 455:
menzen unterscheiden sich klinisch
- Seite 456 und 457:
Menschen auf, die Analphabeten sind
- Seite 458 und 459:
eine Leitlinie zur Behandlung der D
- Seite 460 und 461:
zu starke Blutdrucksenkung als nach
- Seite 462 und 463:
626. Im Rahmen einzelner Initiative
- Seite 464 und 465:
Haus- und Fachärzten könnte eine
- Seite 466 und 467:
tems, wiederum ein hohes Maß an Ko
- Seite 468 und 469:
Disease-Management-Programm ,Demenz
- Seite 470 und 471:
In Modellprojekten haben sich Betre
- Seite 472 und 473:
Erhöhung des zusätzlichen Betreuu
- Seite 474 und 475:
nennen. Die trägerübergreifenden
- Seite 476 und 477:
allem in Großbritannien, Finnland,
- Seite 478 und 479:
656. Alle Reformvorschläge sollten
- Seite 480 und 481:
erachtet. Empfohlen wird das Splitt
- Seite 482 und 483:
Die weitergehende Dynamisierung der
- Seite 484 und 485:
tungskürzungen. Dieser Umstand kan
- Seite 486 und 487:
nächsten Jahrzehnten stark anwachs
- Seite 488 und 489:
5.11 Literatur Abbott, R.D., White,
- Seite 490 und 491:
BQS (Bundesgeschäftsstelle Qualit
- Seite 492 und 493:
DNQP (Deutsches Netzwerk für Quali
- Seite 494 und 495:
Hesse, E. (2002): Versorgung durch
- Seite 496 und 497:
Lauterbach, K. und Wille, E. (2001)
- Seite 498 und 499:
Orgogozo, J.-M., Dartigues, J.-F.,
- Seite 500 und 501:
Runde, P., Giese, R., Kerschke-Ries
- Seite 502 und 503:
Schwerdt, R. und Tschainer, S. (200
- Seite 504 und 505:
Wingenfeld, K (2003): Studien zur N
- Seite 506 und 507:
handelt. In diesen Fällen ist die
- Seite 508 und 509:
Abbildung 26: Entwicklung des Ausga
- Seite 510 und 511:
tigkeit abzuwenden, zu beseitigen,
- Seite 512 und 513:
696. Festbeträge für Hilfsmittel
- Seite 514 und 515:
sen geschlossenen Verträgen abweic
- Seite 516 und 517:
Tabelle 66: Produktgruppen im Hilfs
- Seite 518 und 519:
der Aufnahme eines Produkts in das
- Seite 520 und 521:
Abbildung 27: Aufgabenteilung zwisc
- Seite 522 und 523:
gung zeigt eine geringere Konzentra
- Seite 524 und 525:
Unterversorgung im Hilfsmittelberei
- Seite 526 und 527:
Qualitätssicherung der Hilfsmittel
- Seite 528 und 529:
528 die Aufgabe stellt, den Informa
- Seite 530 und 531:
entfalten, hängt auch von der jewe
- Seite 532 und 533:
Bei zahlreichen Hilfsmitteln kommen
- Seite 534 und 535:
wie Rahmenempfehlungen, die zwische
- Seite 536 und 537:
Abbildung 30: Heilmittelangebot der
- Seite 538 und 539:
Tabelle 69: Therapieformen im Heilm
- Seite 540 und 541:
Art der Störung Diagnosegruppe St
- Seite 542 und 543:
Tabelle 71: Ausgaben für Heilmitte
- Seite 544 und 545:
− finanzierungsrechtliche Rahmenb
- Seite 546 und 547:
Heilmittelrichtlinien im Rahmen ein
- Seite 548 und 549:
750. Noch mehr als in der Arzneimit
- Seite 550 und 551:
550 mittel weiter verwendbar sind o
- Seite 552 und 553:
6.5 Literatur 552 Biermans, M.C.J.,
- Seite 554 und 555:
554 Spitzenverbände der Krankenkas
- Seite 556 und 557:
Die Entdeckung neuer fiebersenkende
- Seite 558 und 559:
763. In der Entwicklungskette einer
- Seite 560 und 561:
Tabelle 72: Entwicklung der Pro-Kop
- Seite 562 und 563:
7.2.2 Die deutschen Arzneimittelaus
- Seite 564 und 565:
Tabelle 75: Anteile der Arzneimitte
- Seite 566 und 567:
Tabelle 76: Ausgabenanteile in der
- Seite 568 und 569:
Abbildung 32: Veränderung der GKV-
- Seite 570 und 571:
warten. Die sinkenden Verordnungsza
- Seite 572 und 573:
7.2.4 Rationalisierungsmöglichkeit
- Seite 574 und 575:
772. Im Unterschied zum Einsparpote
- Seite 576 und 577:
der Analogpräparate in den letzten
- Seite 578 und 579:
Tabelle 80: Komponenten des Wachstu
- Seite 580 und 581:
Exkurs: Mangelnder Preiswettbewerb
- Seite 582 und 583:
werbsfähigkeit von Arzneimitteln (
- Seite 584 und 585: neimittel trotz der internationalen
- Seite 586 und 587: ‚Zuarbeit‘ in der Forschungstä
- Seite 588 und 589: 7.3.2 Die Ausweitung von dezentrale
- Seite 590 und 591: 590 zug auf den Wirkstoff fest vorg
- Seite 592 und 593: Allgemeinmediziner liegen hinsichtl
- Seite 594 und 595: Tabelle 84: Arzneiverordnungen von
- Seite 596 und 597: Fortsetzung von Tabelle 85 596 Allg
- Seite 598 und 599: 791. Auch bei angemessener Würdigu
- Seite 600 und 601: Tabelle 86: Verordnungen von Antihy
- Seite 602 und 603: Abbildung 37: Reduzierung des pharm
- Seite 604 und 605: − bislang nur unzureichend behand
- Seite 606 und 607: kation als ,erste‘ oder ,letzte W
- Seite 608 und 609: Tabelle 87: Liste der Ausnahmeindik
- Seite 610 und 611: 7.5.3 Anforderungen an die Wirtscha
- Seite 612 und 613: 3. die Bewertung evidenzbasierter L
- Seite 614 und 615: der Preissetzung erheblich mehr Spi
- Seite 616 und 617: 807. Die Abschaffung der Arznei- un
- Seite 618 und 619: des Erstattungsbetrages um bis zu e
- Seite 620 und 621: ihrer Praxis auf der Grundlage der
- Seite 622 und 623: Autoren nannten als Gründe, dass n
- Seite 624 und 625: Die Aut-idem-Regelung des AABG grif
- Seite 626 und 627: ken durch die Kassen erfolgen. 189
- Seite 628 und 629: in Form von bevorzugt oder ohne Zus
- Seite 630 und 631: der HMOs verwendet (vgl. Dranove, D
- Seite 632 und 633: 7.6.6 Zuzahlungsregelungen 828. Die
- Seite 636 und 637: enten sollen Verordnung und Kauf vo
- Seite 638 und 639: Zur Ermittlung der Entwicklungskost
- Seite 640 und 641: Abbildung 39: Anzahl innovativer un
- Seite 642 und 643: staatliche Förderung von Parallel-
- Seite 644 und 645: Daten: Im Bereich der Selbstmedikat
- Seite 646 und 647: − das Erstellen vielfältiger Pre
- Seite 648 und 649: − Angaben zu Krankheitshäufigkei
- Seite 650 und 651: 843. Es liegen zahlreiche empirisch
- Seite 652 und 653: die sich direkt an Verbraucher wend
- Seite 654 und 655: viewer oder Herausgeber von Fachzei
- Seite 656 und 657: Vor diesem Hintergrund ist die Offe
- Seite 658 und 659: Abbildung 41: Arzneiverbrauch und K
- Seite 660 und 661: u. Schröder, H. 2004f). Neben dem
- Seite 662 und 663: 3. die Konvergenzhypothese, nach de
- Seite 664 und 665: 858. Nach Daten des Bundesgesundhei
- Seite 666 und 667: senpatienten. Verlässliche Aussage
- Seite 668 und 669: artige Zuordnungen sollten jedoch v
- Seite 670 und 671: notwendigerweise alle im Rahmen der
- Seite 672 und 673: Abbildung 43: Unterschiede in der m
- Seite 674 und 675: − das Arzneimittelangebot hinsich
- Seite 676 und 677: Eine französische Studie in Allgem
- Seite 678 und 679: Abbildung 45: Verhalten des Hausarz
- Seite 680 und 681: weise oder eine Patientenverfügung
- Seite 682 und 683: eizsysteme und Implementierungstech
- Seite 684 und 685:
684 diesbezüglich sowie hinsichtli
- Seite 686 und 687:
686 Ferner wird zumeist nicht unter
- Seite 688 und 689:
vorzeitig abgebrochen worden war, i
- Seite 690 und 691:
daraus resultierende Leitlinienänd
- Seite 692 und 693:
vorliegende Ergebnisse zeigen posit
- Seite 694 und 695:
895. Die durch Pharmakotherapiebera
- Seite 696 und 697:
7.9.5 Pharmakoepidemiologische Date
- Seite 698 und 699:
entung, Tod) ergeben. Wenn die PDbs
- Seite 700 und 701:
- Patienten zwar den gastrointestin
- Seite 702 und 703:
tionsbereichen zum Einsatz gelangen
- Seite 704 und 705:
ökonomischen Aspekten einer angeme
- Seite 706 und 707:
,Arzneiverordnungs-Report’ geht e
- Seite 708 und 709:
schen Zusatznutzen aufweist, ersche
- Seite 710 und 711:
nungsverhalten des Arztes und Compl
- Seite 712 und 713:
712 bung durch besonders qualifizie
- Seite 714 und 715:
wirksamer Standardtherapie bislang
- Seite 716 und 717:
Unterversorgung 928. Die Bedeutung
- Seite 718 und 719:
Unterversorgung 932. Die Diagnose d
- Seite 720 und 721:
7.10 Fazit und Empfehlungen 935. Di
- Seite 722 und 723:
einen erheblichen Beitrag zur Schö
- Seite 724 und 725:
le weitgehend nach europaweit gelte
- Seite 726 und 727:
948. Als Ergänzung zu den Vertrags
- Seite 728 und 729:
parat einem zusätzlichen Patienten
- Seite 730 und 731:
fahrungen gemacht wurden, sollten j
- Seite 732 und 733:
werbung. Die hohen Werbeausgaben si
- Seite 734 und 735:
Persistence einer einmal begonnenen
- Seite 736 und 737:
pause, Coxibe, AT-II-Antagonisten u
- Seite 738 und 739:
Modernisierungsgesetz (GMG) eingef
- Seite 740 und 741:
der ,vierten Hürde‘ im Sinne ein
- Seite 742 und 743:
Bero, L.A., Galbraith, A. and Renni
- Seite 744 und 745:
Danzon, P., Epstein, A. and Nichols
- Seite 746 und 747:
Furler, J.S., Harris, E., Chondros,
- Seite 748 und 749:
Himmel, W., Kochen, M.M., Sorns, U.
- Seite 750 und 751:
Lagerløv, P., Veninga, C.C.M., Mus
- Seite 752 und 753:
National Tracker Survey of Primary
- Seite 754 und 755:
Rathore, S.S., Curtis, J.P., Wang,
- Seite 756 und 757:
Scott, A., Shiell, A., and King, M.
- Seite 758 und 759:
Wasem, J., Greß, St. und Niebuhr,
- Seite 760 und 761:
760
- Seite 762:
Mitglieder des Sachverständigenrat